




 Forschungsmethoden, Studiendesign, Modelle, wissenschaftliches Publizieren
Forschungsmethoden, Studiendesign, Modelle, wissenschaftliches Publizieren
 Biometrie: βίος = Leben, μέτρον = Maß(stab)
Biometrie: βίος = Leben, μέτρον = Maß(stab)| Forschung bedarf eines planvollen Vorgehens:
Definition des Problems, Literaturstudium, rational begründete
Hypothese, Studienplan, methodisch einwandfreies Vorgehen,
akkurates Datenmanagement, Evaluierung und Publikation der Ergebnisse. Wissenschaftlichkeit äußert sich u.a. in der Offenheit gegenüber Falsifikation, d.h. man vermeidet dogmatische Aussagen und stellt sich laufender Überprüfung. Hypothesen werden vorgeschlagen und überprüft, bessere Vorschläge ersetzen gegebenenfalls ihre Vorgänger - der Weg zu Erkenntnisgewinn. Logische (Computer-) oder materielle (mechanische) Modelle kommen zur Anwendung, wenn sie Vorteile gegenüber dem abgebildeten Original bieten: Leichter manipulierbar, verständlicher, finanzierbar, besser beobachtbar. Sie sollen prädiktiven oder erklärenden Wert haben und können zur Hypothesentestung eingesetzt werden. Das Experiment am realen lebenden Objekt können sie allerdings nicht immer ersetzen. Wissenschaftliche Publikationen sollen bestimmten Gütekriterien genügen: Klare Fragestellung und Zielsetzung, adäquates Studiendesign, zutreffende Methoden, ausreichende Zahl der Beobachtungen, geeignete biometrische Vorangsweise, klare Darstellung der Ergebnisse, angemessene Schlussfolgerungen und zitierte Literatur. Auch spielt die Zeitschrift oder das Medium, in der/dem die Studie veröffentlich wurde, eine wichtige Rolle: So weist der Impact Factor einer Zeitschrift auf ihre Akzeptanz und die Bedeutung hin, die ihr in der jeweiligen Community beigemessen wird. Originalpublikationen stellen neue Daten bzw. Verfahren vor; Übersichtsarbeiten (Reviews) fassen die Befunde aus Originalpublikationen zusammen. |
 Publikationen: Qualität
Publikationen: Qualität  Studiendesign
Studiendesign  Wissenschaftliche Modelle
Wissenschaftliche Modelle
 wissenschaftlicher Forschung.
wissenschaftlicher Forschung. 
 Abbildung: Der Weg von der Idee zur Veröffentlichung (und zurück)
Abbildung: Der Weg von der Idee zur Veröffentlichung (und zurück) Festmachen der Fragestellung, Definition des Problems (manch eine Studie scheitert daran, dass nicht klar ist, was eigentlich erforscht werden soll)
Festmachen der Fragestellung, Definition des Problems (manch eine Studie scheitert daran, dass nicht klar ist, was eigentlich erforscht werden soll) Rationaler Ausgangspunkt für die Fragestellung der betreffenden Studie (theoretische Grundlagen, Literaturstudium)
Rationaler Ausgangspunkt für die Fragestellung der betreffenden Studie (theoretische Grundlagen, Literaturstudium) Formulierung einer rational begründeten Hypothese (auf der Basis vorhandener Erkenntnisse)
Formulierung einer rational begründeten Hypothese (auf der Basis vorhandener Erkenntnisse)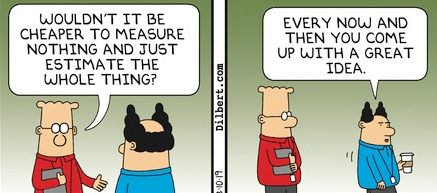
 Abschätzung der wahrscheinlich erfolgversprechenden Strategie
(Studienaufbau, Zahl und Art der notwendigen Beobachtungen / Messungen,
korrekte Messverfahren, bestmögliche statistische Beschreibung,
Bearbeitung und Interpretation)
Abschätzung der wahrscheinlich erfolgversprechenden Strategie
(Studienaufbau, Zahl und Art der notwendigen Beobachtungen / Messungen,
korrekte Messverfahren, bestmögliche statistische Beschreibung,
Bearbeitung und Interpretation) Absicherung in finanzieller (Projektbudget; Sponsoring?) und ethischer Hinsicht (Votum der Ethikkommission; Helsinki-Kriterien: Die Deklaration von Helsinki zu ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen wurde 1964 von der 18. Generalversammlung des Weltärztebundes verabschiedet)
Absicherung in finanzieller (Projektbudget; Sponsoring?) und ethischer Hinsicht (Votum der Ethikkommission; Helsinki-Kriterien: Die Deklaration von Helsinki zu ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen wurde 1964 von der 18. Generalversammlung des Weltärztebundes verabschiedet) Management der Projektdurchführung (Beschäftigung wissenschaftlich versierter MitarbeiterInnen: "Projektstellen")
Management der Projektdurchführung (Beschäftigung wissenschaftlich versierter MitarbeiterInnen: "Projektstellen") Sichtung, Bewertung und Darstellung der resultierenden Daten (Datenmanagement, Statistik)
Sichtung, Bewertung und Darstellung der resultierenden Daten (Datenmanagement, Statistik) Kritische Evaluierung der Ergebnisse (wurden die eingangs gestellten Fragen beantwortet? Gibt es Überraschungen?), Interpretation der Daten (was sagen diese aus?)
Kritische Evaluierung der Ergebnisse (wurden die eingangs gestellten Fragen beantwortet? Gibt es Überraschungen?), Interpretation der Daten (was sagen diese aus?) Adäquate Veröffentlichung (Publikation
Adäquate Veröffentlichung (Publikation  ) des Studienzwecks und -aufbaus, der Daten und Erkenntnisse, Reflexion vor dem Hintergrund bereits vorhandenen Wissens
) des Studienzwecks und -aufbaus, der Daten und Erkenntnisse, Reflexion vor dem Hintergrund bereits vorhandenen Wissens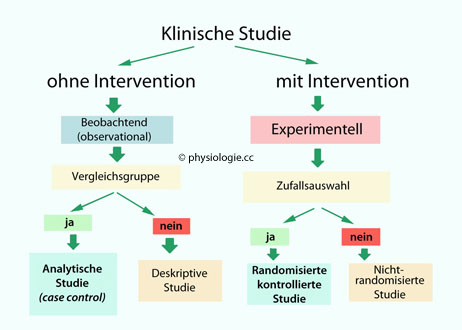
 Abbildung: Klinisches Studiendesign
Abbildung: Klinisches Studiendesign
 Prüfplan (Protocol) - was sind die Ziele der Studie? Wie sollen die Hypothesen geprüft werden? etc
Prüfplan (Protocol) - was sind die Ziele der Studie? Wie sollen die Hypothesen geprüft werden? etc Ethische Zulässigkeit - werden die Helsinki-Kriterien erfüllt? Können Probanden zu Schaden kommen, ist ihre Würde gewahrt? etc
Ethische Zulässigkeit - werden die Helsinki-Kriterien erfüllt? Können Probanden zu Schaden kommen, ist ihre Würde gewahrt? etc Auswahl der Probanden, Art und Größe der Stichproben (Statistische Voraus-Abschätzungen)
Auswahl der Probanden, Art und Größe der Stichproben (Statistische Voraus-Abschätzungen)
 Randomisierung - Selektionseffekte durch (unbewusste) Schieflage (bias) bei der Definition der Stichproben werden vermieden
Randomisierung - Selektionseffekte durch (unbewusste) Schieflage (bias) bei der Definition der Stichproben werden vermieden Verblindung - z.B. double blind,
weder Proband noch Untersucher wissen, ob z.B. ein Placebo oder ein
Verum zum Einsatz kommen, Selbsttäuschungseffekte werden vermieden
Verblindung - z.B. double blind,
weder Proband noch Untersucher wissen, ob z.B. ein Placebo oder ein
Verum zum Einsatz kommen, Selbsttäuschungseffekte werden vermieden Festlegung der zu messenden Zustandsvariablen und Messmethoden (sind diese durchführbar, finanzierbar, für die Fragestellung aussagekräftig, möglichst risiko- und schmerzfrei ...?)
Festlegung der zu messenden Zustandsvariablen und Messmethoden (sind diese durchführbar, finanzierbar, für die Fragestellung aussagekräftig, möglichst risiko- und schmerzfrei ...?) Datenauswertung - ist klar, wie mit den Daten zu verfahren ist?
Datenauswertung - ist klar, wie mit den Daten zu verfahren ist?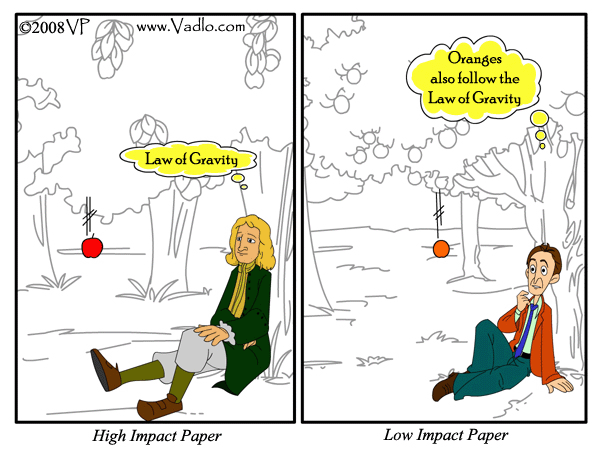
 Abbildung: Nicht jede Idee ist von hohem wissenschaftlichem Rang
Abbildung: Nicht jede Idee ist von hohem wissenschaftlichem Rang

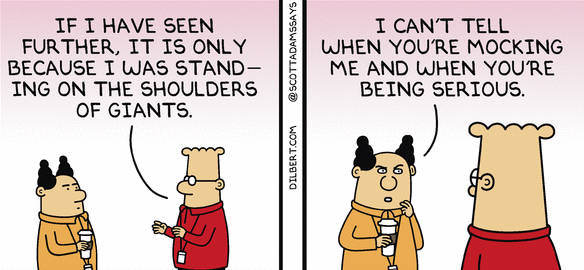 Das
Peer-Review-Verfahren (s. unten) benötigt dann meist mehrere Monate,
Kritik der Begutachter muss aufgenommen und im Text entsprechend
berücksichtigt (oder fundiert widerlegt) werden; im Fall einer
Zurückweisung definiert man die weitere Vorgangsweise (Weiterführung,
Vertiefung oder Abänderung der Untersuchungsstrategie, Suche nach einem
anderen Forum etc).
Das
Peer-Review-Verfahren (s. unten) benötigt dann meist mehrere Monate,
Kritik der Begutachter muss aufgenommen und im Text entsprechend
berücksichtigt (oder fundiert widerlegt) werden; im Fall einer
Zurückweisung definiert man die weitere Vorgangsweise (Weiterführung,
Vertiefung oder Abänderung der Untersuchungsstrategie, Suche nach einem
anderen Forum etc).
Frage: Woher kommt das Wissen, auf dem wir die Logik medizinischer - diagnostischer, therapeutischer, kurativer, prophylaktischer - Maßnahmen aufbauen? Wie gelangt die Heilkunde zu besseren, humaneren, verlässlicheren, schmerzfreieren Methoden und Handlungen? Woher kommt der Fortschritt in der Medizin?
Antwort: Aus planvollen Untersuchungen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden. Dabei gilt das Prinzip der Offenheit (Nachvollziehbarkeit) und Disziplin (Beachtung aller nötigen Regeln).
Die Ergebnisse
solcher Studien werden in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht (publiziert). Wie beurteilt man deren Qualität?
 Dazu wurde vom Institute for Scientific
Information (ISI) in Philadelphia der 'Impact Factor' (IF)
Dazu wurde vom Institute for Scientific
Information (ISI) in Philadelphia der 'Impact Factor' (IF)
 eingeführt. Er ist einer von mehreren Maßzahlen, welche Eigenschaften
wissenschaftlicher Publikationsforen quantifizieren; dazu gehört u.a.
auch die Nachhaltigkeit, mit der Publikationen zitiert werden, die in
einem solchen Organ veröffentlich wurden (citation half-life
- 'Altern' der Information, in Analogie zum radioaktiven Zerfall als
'Halbwertszeit' bezeichnet: die Zeit, nach der die Zitierfrequenz auf
die Hälfte ihres anfänglichen Wertes absinkt).
eingeführt. Er ist einer von mehreren Maßzahlen, welche Eigenschaften
wissenschaftlicher Publikationsforen quantifizieren; dazu gehört u.a.
auch die Nachhaltigkeit, mit der Publikationen zitiert werden, die in
einem solchen Organ veröffentlich wurden (citation half-life
- 'Altern' der Information, in Analogie zum radioaktiven Zerfall als
'Halbwertszeit' bezeichnet: die Zeit, nach der die Zitierfrequenz auf
die Hälfte ihres anfänglichen Wertes absinkt).
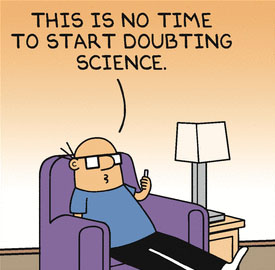 Der IF einer Zeitschrift 'Z' für das Jahr 'Y' gibt
an, wie oft durchschnittlich in einem bestimmten Jahr Y Publikationen genannt wurden,
die in den beiden vorausgegangenen Jahren in Z erschienen sind. Jedes Jahr wird für jede (erfasste) Zeitschrift ein neuer IF
berechnet. Zeitschriften,
deren Arbeiten - aus welchen Gründen
auch immer - oft zitiert werden, erhalten hohe Impactfaktoren. (Über
die Qualität einzelner Arbeiten sagt der IF direkt nichts aus.)
Der IF einer Zeitschrift 'Z' für das Jahr 'Y' gibt
an, wie oft durchschnittlich in einem bestimmten Jahr Y Publikationen genannt wurden,
die in den beiden vorausgegangenen Jahren in Z erschienen sind. Jedes Jahr wird für jede (erfasste) Zeitschrift ein neuer IF
berechnet. Zeitschriften,
deren Arbeiten - aus welchen Gründen
auch immer - oft zitiert werden, erhalten hohe Impactfaktoren. (Über
die Qualität einzelner Arbeiten sagt der IF direkt nichts aus.)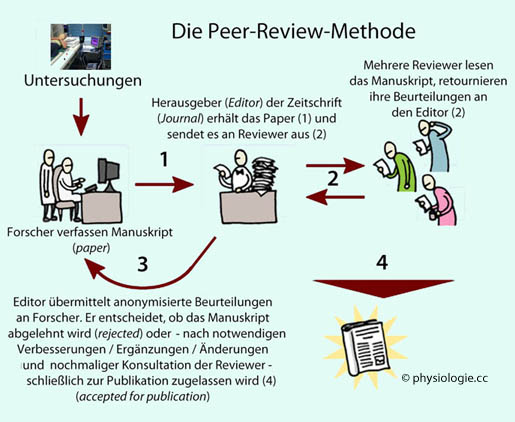

 Abbildung) ist ein Qualitätsfilter,
der dem Leser garantiert, dass die Publikation bereits eine mehrfache
strenge Fachprüfung 'überstanden' hat, bevor sie publik gemacht
wird - ein grundsätzlicher Sicherheitsfaktor.
Abbildung) ist ein Qualitätsfilter,
der dem Leser garantiert, dass die Publikation bereits eine mehrfache
strenge Fachprüfung 'überstanden' hat, bevor sie publik gemacht
wird - ein grundsätzlicher Sicherheitsfaktor.Der IF hängt
also direkt mit dem Qualitätsanspruch des wissenschaftlichen Beirates
zusammen. Ein hoher IF steigert das Renommee der Zeitschrift, und so entsteht
ein Wettlauf der Autoren, in dieser Zeitschrift zu publizieren.
Der IF der Zeitschrift, in der eine Publikation erschienen ist, ist nur ein
Maßstab unter mehreren. Unterschiedliche Fachgebiete (Disziplinen) sind durch unterschiedliche mittlere Häufigkeiten an
Einzelpublikationen (pro Autor) und Impactfaktorhöhen charakterisiert.
So ist etwa ein direkter IF-Vergleich z.B. aus dem Bereich
Molekularbiologie (viele Zitierungen, typisch hohe IF) mit einem spezialisierten
klinischen Fach (z.B. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde - wenige Zeitschriften, geringere Zitationshäufigkeit) nicht sinnvoll.
Wichtig bleibt, Publikationen aufmerksam zu lesen und von Fall zu Fall zu bewerten (Kriterien s. unten), um eine individuelle Entscheidung zu treffen, was sie zu einer konkreten Fragestellung beitragen können.
 Um
festzustellen, wie glaubhaft und/oder relevant die Ergebnisse und
Behauptungen in einer Publikation sind, gibt es eine Reihe von
Maßstäben:
Um
festzustellen, wie glaubhaft und/oder relevant die Ergebnisse und
Behauptungen in einer Publikation sind, gibt es eine Reihe von
Maßstäben:
 Ist eine klare Fragestellung und Zielsetzung erkennbar?
Ist eine klare Fragestellung und Zielsetzung erkennbar?
 Wird der Aufbau der Studie den Zielsetzungen
gerecht? (Studiendesign)
Wird der Aufbau der Studie den Zielsetzungen
gerecht? (Studiendesign)
 Sind die verwendeten Methoden und Maßnahmen adäquat, eindeutig und ausreichend
dargestellt?
Sind die verwendeten Methoden und Maßnahmen adäquat, eindeutig und ausreichend
dargestellt? 
 Welche statistischen Verfahren wurden
angewandt? (Biometrie)
Welche statistischen Verfahren wurden
angewandt? (Biometrie) 

 Sind die Ergebnisse klar und ausreichend dargestellt?
Sind die Ergebnisse klar und ausreichend dargestellt?
 Werden angemessene Schlussfolgerungen gezogen?
Werden angemessene Schlussfolgerungen gezogen?
 Ist die zitierte Literatur adäquat und ausreichend?
Ist die zitierte Literatur adäquat und ausreichend?
 In welcher Zeitschrift ist die Arbeit erschienen?
In welcher Zeitschrift ist die Arbeit erschienen?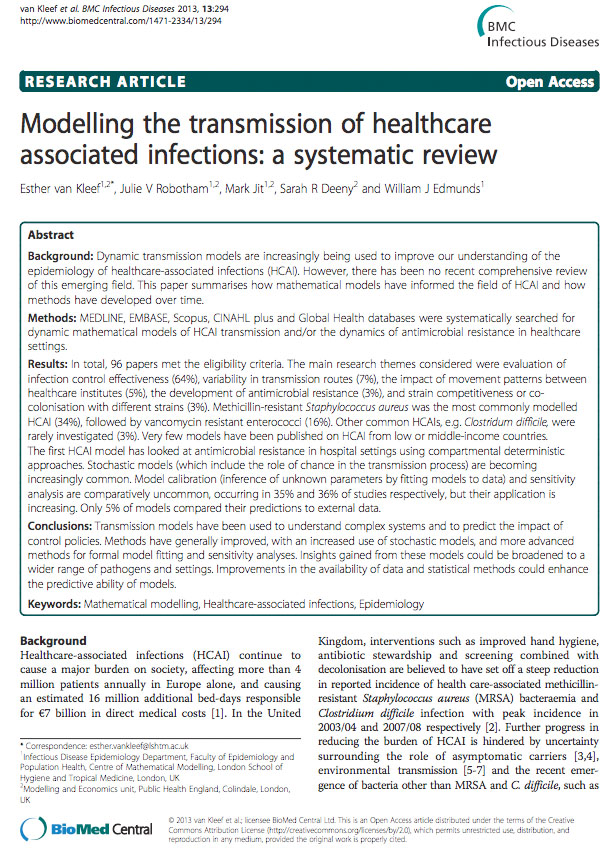
 Abbildung: Beispiel einer Originalpublikation
Abbildung: Beispiel einer Originalpublikation
 Titel der Publikation (title): Kurz, prägnant
Titel der Publikation (title): Kurz, prägnant Autoren (Namen, Institutionen, Adressen, genaue Kontaktdaten des corresponding author)
Autoren (Namen, Institutionen, Adressen, genaue Kontaktdaten des corresponding author) Zusammenfassung (abstract) mit Zitierdaten (Zeitschrift, Jahrgang, Band-Nr, Seitenzahlen) und Stichworten (key terms)
Zusammenfassung (abstract) mit Zitierdaten (Zeitschrift, Jahrgang, Band-Nr, Seitenzahlen) und Stichworten (key terms) Einleitung (background / introduction): Der Leser wird in das Thema "hineingezogen"
Einleitung (background / introduction): Der Leser wird in das Thema "hineingezogen" Methodenteil (procedures, methods, data management / statistics, Studiendesign) - über methodische Fehlerquellen bei der Vermessung von Blutproben
Methodenteil (procedures, methods, data management / statistics, Studiendesign) - über methodische Fehlerquellen bei der Vermessung von Blutproben  s. dort
s. dort Ergebnisteil (results):
Darstellung der gefundenen Daten, übersichtlich organisiert. Meistens
ist es von Vorteil, die wichtigsten Daten in Form von Tabellen (tables)
darzustellen. Dabei sollen Pseudogenauigkeiten vermieden werden (z.B.
Angabe von Mittelwerten auf mehr Stellen als die Meßgenauigkeit hergibt)
Ergebnisteil (results):
Darstellung der gefundenen Daten, übersichtlich organisiert. Meistens
ist es von Vorteil, die wichtigsten Daten in Form von Tabellen (tables)
darzustellen. Dabei sollen Pseudogenauigkeiten vermieden werden (z.B.
Angabe von Mittelwerten auf mehr Stellen als die Meßgenauigkeit hergibt) Besprechung (discussion) mit Eingrenzung / Gültigkeitsbereich (limitations), Schlussfolgerungen (conclusions), Ausblick (perspectives): Der "philosophische" Teil
Besprechung (discussion) mit Eingrenzung / Gültigkeitsbereich (limitations), Schlussfolgerungen (conclusions), Ausblick (perspectives): Der "philosophische" Teil In der Arbeit zitierte wissenschaftliche Literatur
In der Arbeit zitierte wissenschaftliche Literatur  (references): Einheitlich formatiert, in der Reihenfolge der Erwähnung im Text oder alphabetisch nach den Namen der Erstautoren
(references): Einheitlich formatiert, in der Reihenfolge der Erwähnung im Text oder alphabetisch nach den Namen der Erstautoren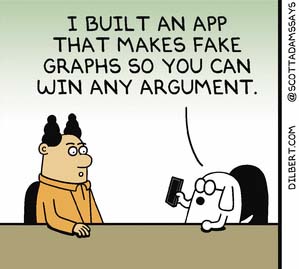 Eine wichtige Rolle spielen auch Abbildungen (figures):
Sie zeigen z.B. Versuchsanordnungen, fassen Daten in übersichtlicher
Form zusammen und geben eine Übersicht über Muster und Zeitverläufe,
die mit Text alleine nicht zu vermitteln wären.
Eine wichtige Rolle spielen auch Abbildungen (figures):
Sie zeigen z.B. Versuchsanordnungen, fassen Daten in übersichtlicher
Form zusammen und geben eine Übersicht über Muster und Zeitverläufe,
die mit Text alleine nicht zu vermitteln wären.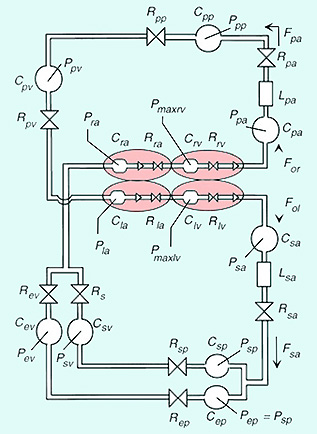
 Abbildung: Hydrodynamisches Kreislaufmodell
Abbildung: Hydrodynamisches Kreislaufmodell F = Strömung
F = Strömung  p = Druck
p = Druck  R = Widerstand
R = Widerstand
 durchzuführen. Modelle sind Abbildungen von Vorgängen (physiologische Modelle; z.B. Modell der Blutdruckentstehung) oder Gegenständen.
Sie bilden Teilaspekte der Realität ab, auf die es in einem bestimmten
Zusammenhang ankommt.
durchzuführen. Modelle sind Abbildungen von Vorgängen (physiologische Modelle; z.B. Modell der Blutdruckentstehung) oder Gegenständen.
Sie bilden Teilaspekte der Realität ab, auf die es in einem bestimmten
Zusammenhang ankommt. Für die
medizinische Forschung ist die Verwendung von Modellen
oft unverzichtbar. Modelle benützt man aus praktischen Gründen:
 Modellkonstrukte sind leichter manipulierbar, durchschaubar, finanzierbar, beobachtbar,
oder haben andere Vorteile gegenüber dem abgebildeten Original.
Modellkonstrukte sind leichter manipulierbar, durchschaubar, finanzierbar, beobachtbar,
oder haben andere Vorteile gegenüber dem abgebildeten Original.
 Sie sollen prädiktiven Wert haben, also das Verhalten realer
Systeme befriedigend voraussagen (z.B. Wetterprognose).
Sie sollen prädiktiven Wert haben, also das Verhalten realer
Systeme befriedigend voraussagen (z.B. Wetterprognose).
 Sie können
zur Überprüfung von Hypothesen eingesetzt werden,
oder zur Entdeckung oder Erklärung von Naturphänomenen (Forschungsmodelle).
Sie können
zur Überprüfung von Hypothesen eingesetzt werden,
oder zur Entdeckung oder Erklärung von Naturphänomenen (Forschungsmodelle).
Ihrer Natur nach gibt es
 logische (z.B. Computerprogramme) und
logische (z.B. Computerprogramme) und materielle Modelle (z.B. mechanisches Kreislaufmodell).
materielle Modelle (z.B. mechanisches Kreislaufmodell).
 theoretische
theoretische  Modelle,
die auf der Basis vorhandenen Wissens über das modellierte Original
konstruiert werden, erklärende Aufgaben erfüllen und Voraussagen
über das Systemverhalten erlauben sollen in Situationen, die
einer direkten Untersuchung nicht zugänglich sind; und
Modelle,
die auf der Basis vorhandenen Wissens über das modellierte Original
konstruiert werden, erklärende Aufgaben erfüllen und Voraussagen
über das Systemverhalten erlauben sollen in Situationen, die
einer direkten Untersuchung nicht zugänglich sind; und  empirische
empirische  Modelle ('black-box-Modelle'),
die nicht von Systemeigenschaften ausgehen, sondern von der Struktur
der vorgefundenen Systemvariablen (z.B. Kurvenanpassung oder
Regressivmodelle).
Modelle ('black-box-Modelle'),
die nicht von Systemeigenschaften ausgehen, sondern von der Struktur
der vorgefundenen Systemvariablen (z.B. Kurvenanpassung oder
Regressivmodelle).
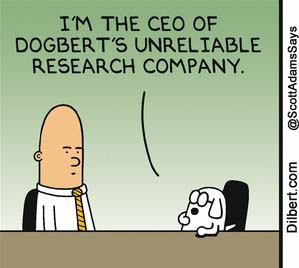 Zur Validierung
des Modells werden experimentelle und Simulationsergebnisse verglichen und
möglichst in Übereinstimmung gebracht. Schrittweise wird die mindestens
nötige Komplexität der Modellstruktur identifiziert, und die Beträge
der verwendeten Modellparameter werden feinjustiert.
Zur Validierung
des Modells werden experimentelle und Simulationsergebnisse verglichen und
möglichst in Übereinstimmung gebracht. Schrittweise wird die mindestens
nötige Komplexität der Modellstruktur identifiziert, und die Beträge
der verwendeten Modellparameter werden feinjustiert.
Kein Modell repräsentiert das Original in allen seinen Eigenschaften. So können Fragen, für deren Beantwortung kein befriedigendes Modell existiert (etwa weil man über das reale System zu wenig weiß bzw. dieses zu komplex funktioniert), nur durch Untersuchung des 'Originals' beantwortet werden (z.B. Untersuchung am realen biologischen System statt 'Alternativmethode' wie Computersimulation oder In-vitro-Versuch). Die Untersuchung hochkomplexer Systeme (wie Organismen, Menschen) erfordert die Anwendung biometrischer Prinzipien und ein entsprechendes Studiendesign.

 Naturwissenschaftliche Forschungspläne enthalten folgende Anteile:
Definition von Fragestellung und Problem; Literaturstudium;
Hypothesenerstellung; Festlegung von Studienaufbau, Zahl und Art der
notwendigen Beobachtungen, Messverfahren; Plan für die statistische Beschreibung,
Bearbeitung und Interpretation der anfallenden Daten; finanzielle und ethische
Absicherung der Vorgangsweise; Projektdurchführung; Datenmanagement, Statistik,
Interpretation der Daten; Verfassen einer Publikation (Studienzweck
und -aufbau, Daten und Erkenntnisse, Reflexion vor dem Hintergrund
bereits vorhandenen Wissens, belegt mit Zitaten); Einsenden an
wissenschaftliche Zeitschrift; Reaktion auf die Kritik der Begutachter;
Veröffentlichung Naturwissenschaftliche Forschungspläne enthalten folgende Anteile:
Definition von Fragestellung und Problem; Literaturstudium;
Hypothesenerstellung; Festlegung von Studienaufbau, Zahl und Art der
notwendigen Beobachtungen, Messverfahren; Plan für die statistische Beschreibung,
Bearbeitung und Interpretation der anfallenden Daten; finanzielle und ethische
Absicherung der Vorgangsweise; Projektdurchführung; Datenmanagement, Statistik,
Interpretation der Daten; Verfassen einer Publikation (Studienzweck
und -aufbau, Daten und Erkenntnisse, Reflexion vor dem Hintergrund
bereits vorhandenen Wissens, belegt mit Zitaten); Einsenden an
wissenschaftliche Zeitschrift; Reaktion auf die Kritik der Begutachter;
Veröffentlichung  Beobachtungsstudien (analytisch oder deskriptiv) bedürfen keiner Intervention, Interventionsstudien
sollten nach Möglichkeit Randomisierungen enthalten. Kontrollgruppen
erhalten z.B. ein Placebo, Verumgruppen die Behandlung, deren Wirkung
getestet werden soll. Bei Doppelblindstudien wissen weder Proband noch Untersucher, ob im Einzelfall Placebo oder Verum zum Einsatz kommt. Die
Gruppen der Untersuchten müssen möglichst gleichmäßig zusammengesetzt
sein (Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand etc). Unabhängige Variable
werden vom Untersucher beeinflusst (z.B. die Dosis
einer Hormongabe), abhängige Variable werden gemessen, um die Reaktion
auf die Manipulation der unabhängigen Variablen zu verfolgen (z.B.
Effekt
der verschiedenen Dosierungen) Beobachtungsstudien (analytisch oder deskriptiv) bedürfen keiner Intervention, Interventionsstudien
sollten nach Möglichkeit Randomisierungen enthalten. Kontrollgruppen
erhalten z.B. ein Placebo, Verumgruppen die Behandlung, deren Wirkung
getestet werden soll. Bei Doppelblindstudien wissen weder Proband noch Untersucher, ob im Einzelfall Placebo oder Verum zum Einsatz kommt. Die
Gruppen der Untersuchten müssen möglichst gleichmäßig zusammengesetzt
sein (Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand etc). Unabhängige Variable
werden vom Untersucher beeinflusst (z.B. die Dosis
einer Hormongabe), abhängige Variable werden gemessen, um die Reaktion
auf die Manipulation der unabhängigen Variablen zu verfolgen (z.B.
Effekt
der verschiedenen Dosierungen) Um die
Bedeutung einer Publikation zur beurteilen, kann man sich am Rang der
Zeitschrift orientieren, in der diese erschienen ist. Der Impact Factor (IF) ist eine solche Maßzahl: Sie
gibt sie an, wie oft durchschnittlich in einem bestimmten Jahr
Publikationen genannt wurden, die in den zwei vorausgegangenen Jahren
in der betreffenden Zeitschrift erschienen sind. Jedes Jahr wird für
die Zeitschrift ein neuer IF berechnet. Zeitschriften, deren Arbeiten
oft zitiert werden, erhalten hohe Impactfaktoren - typischerweise weil für die Beurteilung und Annahme von
Publikationen besonders strenge Maßstäbe angelegt werden. Das
Review-Verfahren ist ein Qualitätsfilter und Sicherheitsfaktor: Publikationen haben
mehrfache hochqualifizierte Fachprüfungen überstanden, bevor sie publik gemacht werden. Die citation half-life ist die Zeit, nach der die Zitierfrequenz auf die Hälfte ihres anfänglichen Wertes absinkt - sie gibt die Nachhaltigkeit an, mit der Publikationen dieses Organs zitiert werden ('Altern' der Information) Um die
Bedeutung einer Publikation zur beurteilen, kann man sich am Rang der
Zeitschrift orientieren, in der diese erschienen ist. Der Impact Factor (IF) ist eine solche Maßzahl: Sie
gibt sie an, wie oft durchschnittlich in einem bestimmten Jahr
Publikationen genannt wurden, die in den zwei vorausgegangenen Jahren
in der betreffenden Zeitschrift erschienen sind. Jedes Jahr wird für
die Zeitschrift ein neuer IF berechnet. Zeitschriften, deren Arbeiten
oft zitiert werden, erhalten hohe Impactfaktoren - typischerweise weil für die Beurteilung und Annahme von
Publikationen besonders strenge Maßstäbe angelegt werden. Das
Review-Verfahren ist ein Qualitätsfilter und Sicherheitsfaktor: Publikationen haben
mehrfache hochqualifizierte Fachprüfungen überstanden, bevor sie publik gemacht werden. Die citation half-life ist die Zeit, nach der die Zitierfrequenz auf die Hälfte ihres anfänglichen Wertes absinkt - sie gibt die Nachhaltigkeit an, mit der Publikationen dieses Organs zitiert werden ('Altern' der Information)  Wissenschaftliche
Modelle werden erstellt, wenn ethische, organisatorische oder andere
Gründe eine direkte Untersuchung des Problems an einem realen System
ausschließen. Sie sind
leichter manipulierbar, durchschaubar, finanzierbar, beobachtbar, oder
haben andere Vorteile gegenüber dem abgebildeten Original. Solche Modelle bilden
Teilaspekte der Realität ab, auf die es im gegebenen
Zusammenhang ankommt, lassen Hypothesen überprüfen und sollten
prädiktiven Wert haben. Man
unterscheidet logische (z.B. Computerprogramm) und materielle
(mechanisches Modell), theoretische (experimentelle Untersuchung nicht
möglich) und empirische Modelle (z.B. Kurvenanpassung). Experimentelle
und
Simulationsergebnisse sollten möglichst übereinstimmen (Validierung).
Ein Modell soll so einfach wie möglich, so komplex wie nötig
sein (Optimierung) Wissenschaftliche
Modelle werden erstellt, wenn ethische, organisatorische oder andere
Gründe eine direkte Untersuchung des Problems an einem realen System
ausschließen. Sie sind
leichter manipulierbar, durchschaubar, finanzierbar, beobachtbar, oder
haben andere Vorteile gegenüber dem abgebildeten Original. Solche Modelle bilden
Teilaspekte der Realität ab, auf die es im gegebenen
Zusammenhang ankommt, lassen Hypothesen überprüfen und sollten
prädiktiven Wert haben. Man
unterscheidet logische (z.B. Computerprogramm) und materielle
(mechanisches Modell), theoretische (experimentelle Untersuchung nicht
möglich) und empirische Modelle (z.B. Kurvenanpassung). Experimentelle
und
Simulationsergebnisse sollten möglichst übereinstimmen (Validierung).
Ein Modell soll so einfach wie möglich, so komplex wie nötig
sein (Optimierung) |
