




 Physiologische
Einflüsse auf das Resultat von Blutuntersuchungen
Physiologische
Einflüsse auf das Resultat von Blutuntersuchungen
 Hämatokrit: αιμα = Blut, κρινειν = urteilen
Hämatokrit: αιμα = Blut, κρινειν = urteilen| Viele
klinische Laborwerte sind von physiologischen Faktoren beeinflusst, die
bei der Interpretation der Messwerte berücksichtigt werden müssen, zum
Beispiel -- ändern sich Blutvolumen, pH-Wert, Lactatspiegel u.a. mit körperlicher Belastung -- wandert bei aufrechter Körperlage Flüssigkeit aus den Kapillaren in das Gewebe. Das steigert den Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration sowie davon abhängige Messwerte (legt sich die Person hin, sinken diese Werte wieder) -- beeinflusst die Aufnahme von Nahrungsstoffen viele Blutwerte, insbesondere gelangen Chylomikronen in das Blut. Die resultierende Trübung des Plasmas behindert die optische Vermessung von Serumproben -- spielt die Uhrzeit eine wichtige Rolle in Bezug auf Hormon- und andere Werte, wenn die Sekretion von der Tageszeit abhängt -- beeinflussen Geschlecht und Alter zahlreiche Laborwerte -- sind bei Schwangeren zahlreiche Referenzbereiche stark verändert -- konzentriert lokale Stauung proximal der Abnahmestelle (Staumanschette!) das Blut ähnlich wie bei Orthostase und beeinflusst die Blutgaswerte. Störeinflüsse sollte man vermeiden. Ist das nicht möglich, müssen sie ausreichend dokumentiert werden. |
 Zeitabhängigkeit
Zeitabhängigkeit  Nüchtern vs. postprandial
Nüchtern vs. postprandial  Geschlecht und Zyklus
Geschlecht und Zyklus  Muskelaktivität
Muskelaktivität  Körperlage
Körperlage  weitere Faktoren
weitere Faktoren
 konstante unbeeinflussbare (z.B. Geschlecht, genetische Konstellation),
konstante unbeeinflussbare (z.B. Geschlecht, genetische Konstellation), veränderliche unbeeinflussbare (z.B. Alter, Höhe über dem Meeresspiegel),
veränderliche unbeeinflussbare (z.B. Alter, Höhe über dem Meeresspiegel), veränderliche beeinflussbare (z.B. Position des Körpers, Nahrungsaufnahme, sportliche Aktivität),
veränderliche beeinflussbare (z.B. Position des Körpers, Nahrungsaufnahme, sportliche Aktivität), 
 Abbildung: Zirkadiane
Abbildung: Zirkadiane  Rhythmen
Rhythmen des hypothalamischen Systems (~3 cm hinter
dem Augapfel gelegen) beeinflusst ("master clock"). Diese steuert auch die Aktivität der
Epiphyse (Zirbeldrüse) und ihre Freisetzung von Melatonin.
Tagesrhythmen werden neural und endokrin vorgegeben.
des hypothalamischen Systems (~3 cm hinter
dem Augapfel gelegen) beeinflusst ("master clock"). Diese steuert auch die Aktivität der
Epiphyse (Zirbeldrüse) und ihre Freisetzung von Melatonin.
Tagesrhythmen werden neural und endokrin vorgegeben. Melatoninspiegel - Maximum um 3 Uhr morgens (
Melatoninspiegel - Maximum um 3 Uhr morgens ( Abbildung). Die Epiphyse (Zirbeldrüse
Abbildung). Die Epiphyse (Zirbeldrüse , glandula pinealis, pineal gland) - ein Teil des Epithalamus im Zwischenhirn - produziert in Dunkelheit das aus Serotonin gebildete Hormon Melatonin. Lichteinfall auf die Netzhaut hemmt die Synthese (
, glandula pinealis, pineal gland) - ein Teil des Epithalamus im Zwischenhirn - produziert in Dunkelheit das aus Serotonin gebildete Hormon Melatonin. Lichteinfall auf die Netzhaut hemmt die Synthese ( s. dort).
s. dort). In Dunkelheit steigt die Ausschüttung und damit der
Melatoninspiegel im Blut (bei jungen Menschen mehr als 10-fach, bei
älteren etwa 3-fach).
In Dunkelheit steigt die Ausschüttung und damit der
Melatoninspiegel im Blut (bei jungen Menschen mehr als 10-fach, bei
älteren etwa 3-fach). 
 Abbildung).
Abbildung).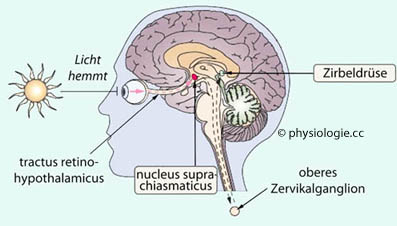
 Abbildung: Licht (<500 nm) hemmt die Melatoninproduktion
Abbildung: Licht (<500 nm) hemmt die Melatoninproduktion
 Jet-Lag-Pille:
Die Wirksamkeit von Melatonin in einer Dosierung von 0,5–5 mg gegen
unangenehme Symptome der Zeitumstellung ist umstritten, und
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können die Schlafrhythmik
störend beeinflussen.
Jet-Lag-Pille:
Die Wirksamkeit von Melatonin in einer Dosierung von 0,5–5 mg gegen
unangenehme Symptome der Zeitumstellung ist umstritten, und
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können die Schlafrhythmik
störend beeinflussen.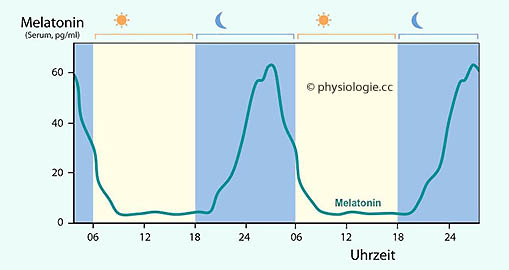
 Abbildung: Zirkadianer Rhythmus des Melatoninspiegels
Abbildung: Zirkadianer Rhythmus des Melatoninspiegels Im
Winter kann der Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht bleiben, was
Schlafstörungen und "Winterdepression" zur Folge haben kann. Lichttherapie
hilft: Weißes Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts entspricht,
morgens (unmittelbar nach dem Aufwachen) angewandt, hemmt die
Melatoninsekretion und hellt die Stimmungslage auf.
Im
Winter kann der Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht bleiben, was
Schlafstörungen und "Winterdepression" zur Folge haben kann. Lichttherapie
hilft: Weißes Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts entspricht,
morgens (unmittelbar nach dem Aufwachen) angewandt, hemmt die
Melatoninsekretion und hellt die Stimmungslage auf. ACTH- und Cortisolspiegel am höchsten morgens,
tiefste Werte nachts; die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache (
ACTH- und Cortisolspiegel am höchsten morgens,
tiefste Werte nachts; die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache ( Abbildung).
Abbildung).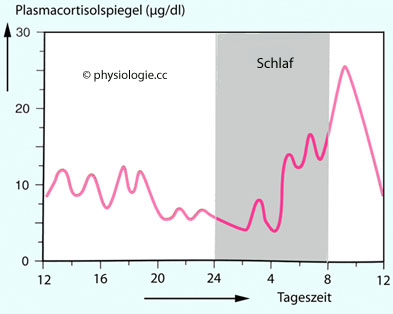
 Abbildung: Zeitabhängigkeit des Cortisolspiegels im Blutplasma
Abbildung: Zeitabhängigkeit des Cortisolspiegels im Blutplasma vgl. dort
vgl. dort
 GHRH- und GH-Werte sind am höchsten (höchste pulsatile
Frequenz) in der Nacht sowie bei starker körperlicher Belastung.
GHRH- und GH-Werte sind am höchsten (höchste pulsatile
Frequenz) in der Nacht sowie bei starker körperlicher Belastung.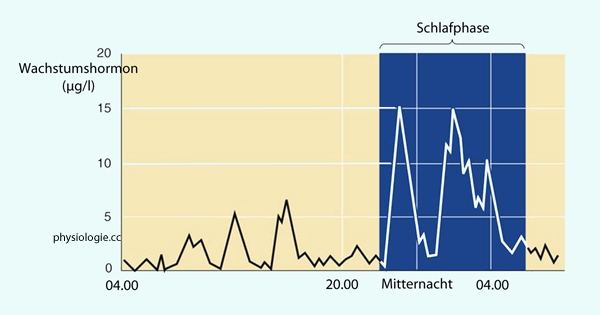
 Abbildung: Wachstumshormon-Bursts im Blutplasma
Abbildung: Wachstumshormon-Bursts im Blutplasma
 Zirkadiane Freisetzung von TRH / TSH abends
ansteigend, am höchsten in den frühen Morgenstunden (
Zirkadiane Freisetzung von TRH / TSH abends
ansteigend, am höchsten in den frühen Morgenstunden ( Abbildung).
Abbildung).
 Abbildung: Zirkadianer Verlauf des TSH-Spiegels im Blut einer Gruppe 33 gesunder Personen
Abbildung: Zirkadianer Verlauf des TSH-Spiegels im Blut einer Gruppe 33 gesunder Personen
 Auch die Körpertemperatur
(Ruhebedingungen) zeigt einen zirkadianen Rhythmus - mit niedrigsten Werten
in der Nacht (3-6 Uhr) und höchsten nachmittags (15-18 Uhr). Die
Amplitude beträgt etwa 1°C. Die Steuerung obliegt Neuronen im vorderen Hypothalamus (nucleus suprachiasmaticus), abhängig von Hell-Dunkel-Zyklen.
Auch die Körpertemperatur
(Ruhebedingungen) zeigt einen zirkadianen Rhythmus - mit niedrigsten Werten
in der Nacht (3-6 Uhr) und höchsten nachmittags (15-18 Uhr). Die
Amplitude beträgt etwa 1°C. Die Steuerung obliegt Neuronen im vorderen Hypothalamus (nucleus suprachiasmaticus), abhängig von Hell-Dunkel-Zyklen. s. dort).
Nüchtern liegt der normale Blutzuckerwert bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5
mM), nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit (postprandial
s. dort).
Nüchtern liegt der normale Blutzuckerwert bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5
mM), nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit (postprandial  ) kann er sich physiologischerweise fast verdoppeln (bis ~160
mg/dl oder ~9 mM), um dann über mehrere Stunden wieder in den
Nüchtern-Referenzbereich zurückzukehren.
) kann er sich physiologischerweise fast verdoppeln (bis ~160
mg/dl oder ~9 mM), um dann über mehrere Stunden wieder in den
Nüchtern-Referenzbereich zurückzukehren. Atemvolumina, ventilatorische Sollwerte,
Atemvolumina, ventilatorische Sollwerte, Muskelfasertypen,
Muskelfasertypen, Energieumsatz,
Energieumsatz, Elektrolyt- und Wasserhaushalt,
Elektrolyt- und Wasserhaushalt,  Harnwerte,
Harnwerte,  Blasenmotorik,
Blasenmotorik, Eisenbedarf,
Eisenbedarf, Leberwerte,
Leberwerte, Körperzusammensetzung,
Körperzusammensetzung, Hormonwerte (diese folgen bestimmten Profilen, die auch vom Alter
- juvenil, adult, prä-, postmenopausal - abhängen), Beispielsweise
steigert Testosteron die Synthese von Erythropoetin, Östrogene senken
sie (s. dort), mit dem Resultat unterschiedlicher Hämoglobin- und Hämatokritwerte bei Männern vs. Frauen.
Hormonwerte (diese folgen bestimmten Profilen, die auch vom Alter
- juvenil, adult, prä-, postmenopausal - abhängen), Beispielsweise
steigert Testosteron die Synthese von Erythropoetin, Östrogene senken
sie (s. dort), mit dem Resultat unterschiedlicher Hämoglobin- und Hämatokritwerte bei Männern vs. Frauen. s. dort).
s. dort). Farbensinnstörungen
betreffen Männer viel häufiger /8%) als Frauen (0,4%), weil die
entsprechenden Gene (und allfällige Defekte) X-chromosomal codiert
sind.
Farbensinnstörungen
betreffen Männer viel häufiger /8%) als Frauen (0,4%), weil die
entsprechenden Gene (und allfällige Defekte) X-chromosomal codiert
sind. 
 Abbildung: Zeitverlauf der Lactatkonzentration im Blutplasma nach maximaler körperlicher Belastung (Beispiel)
Abbildung: Zeitverlauf der Lactatkonzentration im Blutplasma nach maximaler körperlicher Belastung (Beispiel)
 Veränderungen von Blutgaswerten, insbesondere durch Bildung saurer Valenzen bei unvollständigem Abbau von Energieträgern ("Sauerstoffschuld"). Der Milchsäurespiegel (Ruhewert 0,5-2,2 mM) steigt über die "Lactatschwelle"
(anaerobe Schwelle) an - die resultierende nicht-respiratorische
Azidose wird rasch kompensiert - und bleibt nach der Belastung bis zu
eine Stunde erhöht (
Veränderungen von Blutgaswerten, insbesondere durch Bildung saurer Valenzen bei unvollständigem Abbau von Energieträgern ("Sauerstoffschuld"). Der Milchsäurespiegel (Ruhewert 0,5-2,2 mM) steigt über die "Lactatschwelle"
(anaerobe Schwelle) an - die resultierende nicht-respiratorische
Azidose wird rasch kompensiert - und bleibt nach der Belastung bis zu
eine Stunde erhöht ( Abbildung)
Abbildung)  Hämokonzentration (erhöhte Plasmaeiweiß-
und Hämatokritwerte)
Hämokonzentration (erhöhte Plasmaeiweiß-
und Hämatokritwerte) Hyperthermie
Hyperthermie Veränderungen im Zytokinmuster
Veränderungen im Zytokinmuster Mobilisierung von Leukozyten, die nur lose an die
Endothelien in der Mikrozirkulation (Kapillaren) angeheftet sind
(Verteilungsleukozytose, Pseudoneutrophilie).
Mobilisierung von Leukozyten, die nur lose an die
Endothelien in der Mikrozirkulation (Kapillaren) angeheftet sind
(Verteilungsleukozytose, Pseudoneutrophilie). Am
Beispiel des Lactatspiegels sieht man, dass diese Änderungen einen spezifischen Zeitverlauf aufweisen. Wird eine Blutprobe nach körperlicher Anstrengung (z.B. Treppensteigen) gewonnen,
sind veränderte Laborwerte zu erwarten - u.U. über mehrere Stunden nach der Belastung.
Am
Beispiel des Lactatspiegels sieht man, dass diese Änderungen einen spezifischen Zeitverlauf aufweisen. Wird eine Blutprobe nach körperlicher Anstrengung (z.B. Treppensteigen) gewonnen,
sind veränderte Laborwerte zu erwarten - u.U. über mehrere Stunden nach der Belastung. Regulation (Barorezeptor-Reflexe) beim Aufrichten des Körpers führt
nicht nur zu hämodynamischen Veränderungen (Steigerung der
Herzfrequenz, Erniedrigung des Herzminutenvolumens), sondern auch zu
Veränderungen zahlreicher Blut-Laborwerte:
Regulation (Barorezeptor-Reflexe) beim Aufrichten des Körpers führt
nicht nur zu hämodynamischen Veränderungen (Steigerung der
Herzfrequenz, Erniedrigung des Herzminutenvolumens), sondern auch zu
Veränderungen zahlreicher Blut-Laborwerte: 
 Abbildung: Zeitverlauf und Ausmaß der Änderung von Blutwerten nach passivem Aufrichten des Körpers (head up tilt): Typische Muster
Abbildung: Zeitverlauf und Ausmaß der Änderung von Blutwerten nach passivem Aufrichten des Körpers (head up tilt): Typische Muster
 wird Flüssigkeit aus der Mikrozirkulation der
kaudalen Körperpartien ins Gewebe verlagert (kapilläre Filtration),
wird Flüssigkeit aus der Mikrozirkulation der
kaudalen Körperpartien ins Gewebe verlagert (kapilläre Filtration),  das
Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),
das
Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),  der Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration
nehmen insgesamt zu, und
damit
der Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration
nehmen insgesamt zu, und
damit  alle abhängigen Messwerte, wie z.B. Hämoglobinkonzentration und
kolloidosmotischer Druck.
alle abhängigen Messwerte, wie z.B. Hämoglobinkonzentration und
kolloidosmotischer Druck.  Hormonwerte steigen als Ausdruck von
Regulationsvorgängen (Stabilisierung des Blutdrucks) an (
Hormonwerte steigen als Ausdruck von
Regulationsvorgängen (Stabilisierung des Blutdrucks) an ( Abbildung).
Abbildung). Auch hier zeigt sich, wie alltägliche Einflüsse Laborwerte im Blut physiologischerweise verändern können.
Auch hier zeigt sich, wie alltägliche Einflüsse Laborwerte im Blut physiologischerweise verändern können.| Wechselt man von der Rückenlage zur aufrechten Position, dann * steigt die Pulsfrequenz, * sinkt das Herzminutenvolumen, * nimmt das Schlagvolumen stärker ab als das Herzminutenvolumen, * steigt der periphere Widerstand (TPR), * sinkt die Durchblutung von Nieren und Darm |
 Bei lokaler Stauung
(Staubinde für Blutabnahme!) z.B. am
Arm kommt es im betroffenen Gebiet zu kapillärer Filtration und lokaler
Hämokonzentration, die
Werte für Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundenen Werten
gebundener Stoffe wie z.B. Lipoproteinen) und Hämatokrit /
Hämoglobinkonzentration steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß
und Dauer der Stauung). Nimmt man Blut aus einer betroffenen Vene ab,
sind die Laborwerte entsprechend verfälscht.
Bei lokaler Stauung
(Staubinde für Blutabnahme!) z.B. am
Arm kommt es im betroffenen Gebiet zu kapillärer Filtration und lokaler
Hämokonzentration, die
Werte für Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundenen Werten
gebundener Stoffe wie z.B. Lipoproteinen) und Hämatokrit /
Hämoglobinkonzentration steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß
und Dauer der Stauung). Nimmt man Blut aus einer betroffenen Vene ab,
sind die Laborwerte entsprechend verfälscht. Einfluss des Alters
Einfluss des Alters  s. dort
s. dort Davon abgesehen
sind sämtliche relevanten Bedingungen bei Abnahme zu
berücksichtigen bzw. zu dokumentieren, wie
Davon abgesehen
sind sämtliche relevanten Bedingungen bei Abnahme zu
berücksichtigen bzw. zu dokumentieren, wie  Art des Blutes
Art des Blutes arteriell? Arterielles Blut ist sauerstoffgesättigt, die Punktion technisch schwieriger
arteriell? Arterielles Blut ist sauerstoffgesättigt, die Punktion technisch schwieriger venös? Venöses Blut je nach Drainagegebiet unterschiedlich zusammengesetzt
venös? Venöses Blut je nach Drainagegebiet unterschiedlich zusammengesetzt Kapillarblut?
Arterielles Blut, das durch Einstich in Ohrläppchen, Fingerbeere oder
Ferse gewonnen und in Kapillarröhrchen eingebracht wird (Nachteil:
geringe Probenmenge)
Kapillarblut?
Arterielles Blut, das durch Einstich in Ohrläppchen, Fingerbeere oder
Ferse gewonnen und in Kapillarröhrchen eingebracht wird (Nachteil:
geringe Probenmenge) Über Unterschiede zwischen arteriellen und venösen Blutproben s. auch dort
Über Unterschiede zwischen arteriellen und venösen Blutproben s. auch dort
 Abbildung: Entnahme einer Kapillarblutprobe aus der Fingerbeere
Abbildung: Entnahme einer Kapillarblutprobe aus der Fingerbeere
 Lagerung - Fehlerquellen sind z.B.
Lagerung - Fehlerquellen sind z.B. Transport und Aufbewahrung einer
Probe (Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?)
Transport und Aufbewahrung einer
Probe (Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?)  Schließlich
können bei der Messung selbst (also im Labor) Fehler auftreten, es kann auch zu Verwechslung von Bioproben kommen. Außerdem ist jede Messung mit
einer gewissen Unsicherheit behaftet (Reliabilität: Frage
der Absolutgenauigkeit und Präzision). Die Angebrachtheit einer Methode
für einen bestimmten Zweck kann ebenfalls fraglich sein
(Validität).
Schließlich
können bei der Messung selbst (also im Labor) Fehler auftreten, es kann auch zu Verwechslung von Bioproben kommen. Außerdem ist jede Messung mit
einer gewissen Unsicherheit behaftet (Reliabilität: Frage
der Absolutgenauigkeit und Präzision). Die Angebrachtheit einer Methode
für einen bestimmten Zweck kann ebenfalls fraglich sein
(Validität).
 Zirkadiane Schwankungen: Ab dem 3.
Lebensmonat stellt sich der übliche Melatonin-Tagesrhythmus
ein, mit höchsten Blutwerten um 3 Uhr morgens. Die
Bildung in der Epiphyse wird durch Lichteinfall auf die Netzhaut
gehemmt, in Dunkelheit steigt sie an (bei jungen Menschen >10-fach,
bei älteren
~3-fach).
Melatonin beteiligt sich an der Auslösung der Tiefschlafphase und regt
die Ausschüttung von GH an. Im Winter kann der Melatoninspiegel auch
tagsüber erhöht bleiben (Schlafstörungen, "Winterdepression"). Die ACTH- und Cortisolspiegel sind morgens am höchsten, nachts am niedrigsten, die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache. GHRH- und GH-Werte
sind am höchsten (höchste pulsatile Frequenz) in der Nacht und bei
starker körperlicher Belastung. Die pulsatile Freisetzung von TRH / TSH steigt abends an (Maximum in den frühen Morgenstunden) Zirkadiane Schwankungen: Ab dem 3.
Lebensmonat stellt sich der übliche Melatonin-Tagesrhythmus
ein, mit höchsten Blutwerten um 3 Uhr morgens. Die
Bildung in der Epiphyse wird durch Lichteinfall auf die Netzhaut
gehemmt, in Dunkelheit steigt sie an (bei jungen Menschen >10-fach,
bei älteren
~3-fach).
Melatonin beteiligt sich an der Auslösung der Tiefschlafphase und regt
die Ausschüttung von GH an. Im Winter kann der Melatoninspiegel auch
tagsüber erhöht bleiben (Schlafstörungen, "Winterdepression"). Die ACTH- und Cortisolspiegel sind morgens am höchsten, nachts am niedrigsten, die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache. GHRH- und GH-Werte
sind am höchsten (höchste pulsatile Frequenz) in der Nacht und bei
starker körperlicher Belastung. Die pulsatile Freisetzung von TRH / TSH steigt abends an (Maximum in den frühen Morgenstunden)  Nahrungsaufnahme verändert den Blutzuckerspiegel
und gekoppelte Hormonausschüttung (Insulin etc). Nüchtern liegt der
Glucosespiegel bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5 mM), postprandial bis
~160 mg/dl / ~9 mM (Nüchternwerte stellen sich nach einigen Stunden wieder ein).
Chylomikronen (Fettresorption) trüben das Serum und stören die Photometrie
(Nüchtern-Serum für zahlreiche Laborbestimmungen erforderlich) Nahrungsaufnahme verändert den Blutzuckerspiegel
und gekoppelte Hormonausschüttung (Insulin etc). Nüchtern liegt der
Glucosespiegel bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5 mM), postprandial bis
~160 mg/dl / ~9 mM (Nüchternwerte stellen sich nach einigen Stunden wieder ein).
Chylomikronen (Fettresorption) trüben das Serum und stören die Photometrie
(Nüchtern-Serum für zahlreiche Laborbestimmungen erforderlich) Das Geschlecht
beeinflusst fast alle klinischen Messwerte, u.a. Kreislauf, Atmung, Körperzusammensetzung,
Blutbild, Hormonprofile; bei Frauen müssen zyklusabhängige Größen mit Rücksicht auf die
Zyklusphase bzw. Einnahme von Hormonpräparaten bewertet werden Das Geschlecht
beeinflusst fast alle klinischen Messwerte, u.a. Kreislauf, Atmung, Körperzusammensetzung,
Blutbild, Hormonprofile; bei Frauen müssen zyklusabhängige Größen mit Rücksicht auf die
Zyklusphase bzw. Einnahme von Hormonpräparaten bewertet werden Körperliche
Belastung verändert mehrere Blutwerte (z.B. pH / Lactat: Ruhe-Referenzwert ≤2,2 mM), führt zu Hämokonzentration (erhöhte
Plasmaeiweiß- und Hämatokritwerte), Hyperthermie, veränderten
Zytokinmustern, Mobilisierung von Leukozyten (Verteilungsleukozytose,
Pseudoneutrophilie). Nach körperlicher Anstrengung sind u.U. über mehrere Stunden veränderte Laborwerte zu erwarten Körperliche
Belastung verändert mehrere Blutwerte (z.B. pH / Lactat: Ruhe-Referenzwert ≤2,2 mM), führt zu Hämokonzentration (erhöhte
Plasmaeiweiß- und Hämatokritwerte), Hyperthermie, veränderten
Zytokinmustern, Mobilisierung von Leukozyten (Verteilungsleukozytose,
Pseudoneutrophilie). Nach körperlicher Anstrengung sind u.U. über mehrere Stunden veränderte Laborwerte zu erwarten  Beim Aufrichten
des Körpers kommt es zu Umverteilung des Blutvolumens, hydrostatische Druckänderungen
in den Gefäßen, Erniedrigung des
Herzminutenvolumens, Steigerung der Herzfrequenz und veränderte Durchblutungsmuster (Barorezeptorreflex) sowie Veränderung zahlreicher Laborwerte: Flüssigkeit
wird filtriert (Beine), das Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),
Hämatokrit, Plasmaeiweißkonzentration und abhängige Messwerte (Hämoglobinkonzentration, kolloidosmotischer Druck) nehmen zu; Hormonwerte ändern sich als Ausdruck von Regulationsvorgängen Beim Aufrichten
des Körpers kommt es zu Umverteilung des Blutvolumens, hydrostatische Druckänderungen
in den Gefäßen, Erniedrigung des
Herzminutenvolumens, Steigerung der Herzfrequenz und veränderte Durchblutungsmuster (Barorezeptorreflex) sowie Veränderung zahlreicher Laborwerte: Flüssigkeit
wird filtriert (Beine), das Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),
Hämatokrit, Plasmaeiweißkonzentration und abhängige Messwerte (Hämoglobinkonzentration, kolloidosmotischer Druck) nehmen zu; Hormonwerte ändern sich als Ausdruck von Regulationsvorgängen  Bei lokaler
Stauung (Staubinde für Blutabnahme) kommt es im betreffenden Gebiet zu
Filtration und lokaler Hämokonzentration, Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundene Werte gebundener
Stoffe wie z.B. Lipoproteine) und Hämatokrit / Hämoglobinkonzentration
steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß und Dauer der Stauung) Bei lokaler
Stauung (Staubinde für Blutabnahme) kommt es im betreffenden Gebiet zu
Filtration und lokaler Hämokonzentration, Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundene Werte gebundener
Stoffe wie z.B. Lipoproteine) und Hämatokrit / Hämoglobinkonzentration
steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß und Dauer der Stauung) Fehlerquellen durch
Lagerung einer Blutprobe sind z.B. Blutsenkung (schwerkraftbedingte
Entmischung des Blutes) oder Hämolyse (dadurch werden die meisten
photometrischen Messungen verfälscht), Transport und Aufbewahrung
(Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?), Messung und Beurteilung (Reliabilität, Absolutgenauigkeit / Präzision, Validität) Fehlerquellen durch
Lagerung einer Blutprobe sind z.B. Blutsenkung (schwerkraftbedingte
Entmischung des Blutes) oder Hämolyse (dadurch werden die meisten
photometrischen Messungen verfälscht), Transport und Aufbewahrung
(Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?), Messung und Beurteilung (Reliabilität, Absolutgenauigkeit / Präzision, Validität) |
