




 Urodynamik: Ureter und Harnblase
Urodynamik: Ureter und Harnblase
 Detrusion: detrudere = wegstoßen (trudere = drängen, treiben)
Detrusion: detrudere = wegstoßen (trudere = drängen, treiben)| Das
Nierenbecken hat 5-10 ml Fassungsvermögen, die Harnblase bis 300 ml und
mehr. Die Harnbildung beträgt normalerweise ~1 ml/min. Der Druck im Nierenbecken beträgt ~15 mmHg; steigt er an,
triggert eine Schrittmacherzone am
Abgang des Harnleiters (Länge: 25-30 cm) peristaltische
Kontraktionswellen, die Harn gegen ein Druckgefälle von bis zu 60 mmHg
und mit
einer Geschwindigkeit von einigen cm pro Sekunde in die Blase befördern. Die Ureterperistaltik funktioniert autonom und wird durch nervale Einflüsse modifiziert. Der Ruhedruck in der Blase beträgt nur wenige mmHg; steigt er an (z.B. ~10 mmHg bei ~200 ml Füllungsvolumen), werden Dehnungsrezeptoren gereizt, bei weiterem Volumenanstieg tritt Harndrang auf. Die leere Blase hat eine Wanddicke von ≥5 mm, ist sie maximal gedehnt, nur mehr ~2 mm ("plastische" Umlagerung der Zellen in der Blasenwand). Die Dichtigkeit (Kontinenz) der Harnblase ist durch den Dauertonus des Sphinkterapparates gegeben: Der innere glattmuskuläre Teil wird durch sympathische Fasern angeregt, der äußere quergesteifte steht unter dem Einfluss somatischer Fasern (willkürlich steuerbar). Das direkt zuständige Reflexzentrum liegt im Rückenmark (spinale Ebene: Lumbal- und Sakralmark). Zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) sind übergeordnet: Dazu zählen das pontine Miktionszentrum sowie kortikale Gebiete, die perzeptive, emotionale, vegetative und motorische Aspekte integrieren. Efferent wirken vegetativ das lumbal-sympathische (über den N. hypogastricus) und das parasympathisch-sakrale Zentrum (über den N. splanchnicus), motorische Fasern (über den N. pudendus) stammen aus dem Sakralmark (Onuf'scher Kern). Der Detrusionsreflex stellt von sympathisch-motorisch gesteuerter Kontinenz (Blasendichtigkeit) auf parasympathisch verwaltete Detrusion (Blasenentleerung) um - er inaktiviert den Sphinkterapparat und regt die Kontraktion der Harnblase an. Eine Blasenentleerung dauert physiologischerweise nicht länger als 30 Sekunden. |
 Blasenfüllung und Kontinenz
Blasenfüllung und Kontinenz  Blasenkontrolle
Blasenkontrolle  Detrusion
Detrusion
 Untersuchung der Blasenfunktion
Untersuchung der Blasenfunktion Urodynamik, Uroflowmetrie, Cystometrie
Urodynamik, Uroflowmetrie, Cystometrie
 Core messages
Core messages Abbildung).
Abbildung). 
 Abbildung: Die Schrittmacherzone des Nierenbeckens ist der Ursprung der Ureterperistaltik
Abbildung: Die Schrittmacherzone des Nierenbeckens ist der Ursprung der Ureterperistaltik
 Komplex
(Nierenbecken und Harnleiter) kann einen Druckanstieg in der Niere
verhindern, indem er peristaltische Kontraktionswellen generiert. Dabei werden Drucke
bis 80 cm Wassersäule (8 kPa) aufgebaut bzw. überwunden.
Komplex
(Nierenbecken und Harnleiter) kann einen Druckanstieg in der Niere
verhindern, indem er peristaltische Kontraktionswellen generiert. Dabei werden Drucke
bis 80 cm Wassersäule (8 kPa) aufgebaut bzw. überwunden. Die Ureterperistaltik
dient dem aktiven Transport des Inhalts des Ureters vom Nierenbecken
zur Harnblase. Sie entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der
glatten Muskulatur der Ureterwand, breitet sich - ausgehend von einer Schrittmacherzone
im Nierenbeckenbereich - wellenförmig aus und wird von Kontraktions-
und Relaxationsphasen der Ring- und Längsmuskulatur getragen. Die
Ureterperistaltik benötigt keine neurale Steuerung und tritt auch bei
Denervierung des
Ureters auf, ist aber durch autonome Nerven modifizierbar.
Die Ureterperistaltik
dient dem aktiven Transport des Inhalts des Ureters vom Nierenbecken
zur Harnblase. Sie entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der
glatten Muskulatur der Ureterwand, breitet sich - ausgehend von einer Schrittmacherzone
im Nierenbeckenbereich - wellenförmig aus und wird von Kontraktions-
und Relaxationsphasen der Ring- und Längsmuskulatur getragen. Die
Ureterperistaltik benötigt keine neurale Steuerung und tritt auch bei
Denervierung des
Ureters auf, ist aber durch autonome Nerven modifizierbar.
 Abbildung).
Abbildung). 

 Abbildung: Verteilung von α- and β-adrenergen Rezeptoren in Niere, Ureter und Harnblase
Abbildung: Verteilung von α- and β-adrenergen Rezeptoren in Niere, Ureter und Harnblase
 (spontanaktive Schrittmacherzellen im Nierenbecken, die als Gruppe funktionieren - multiple coupled oscillators). Druckanstieg wirkt auf dieses System synchronisierend und überschwellig, und induziert rhythmische Entladungen.
(spontanaktive Schrittmacherzellen im Nierenbecken, die als Gruppe funktionieren - multiple coupled oscillators). Druckanstieg wirkt auf dieses System synchronisierend und überschwellig, und induziert rhythmische Entladungen.  Abbildung unten). Zusätzlich wirkt die Ureterperistaltik refluxverhindernd.
Abbildung unten). Zusätzlich wirkt die Ureterperistaltik refluxverhindernd. auftreten. Zwar findet dann immer noch (reduzierte) glomeruläre
Filtration statt, diese wird aber durch tubuläre Filtration vollständig
kompensiert, die Harnbildung erlischt (Anurie).
auftreten. Zwar findet dann immer noch (reduzierte) glomeruläre
Filtration statt, diese wird aber durch tubuläre Filtration vollständig
kompensiert, die Harnbildung erlischt (Anurie). ) am Blasenausgang und in
der Wand der Harnröhre (Urethra) bewirken die Dichtigkeit (Kontinenz
) am Blasenausgang und in
der Wand der Harnröhre (Urethra) bewirken die Dichtigkeit (Kontinenz  )
der Blase.
)
der Blase. 
 des Sakralmarks). Der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt.
Zusammen ergeben diese Faktoren eine Blasendichtigkeit, die bis zu
mehreren kPa Blaseninnendruck reicht (z.B. bei Ausüben von Sportarten,
bei denen der intraabdominelle Druck ansteigt). Der Ruhedruck beträgt ~1 kPa bei der Frau und ~2 kPa beim Mann.
des Sakralmarks). Der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt.
Zusammen ergeben diese Faktoren eine Blasendichtigkeit, die bis zu
mehreren kPa Blaseninnendruck reicht (z.B. bei Ausüben von Sportarten,
bei denen der intraabdominelle Druck ansteigt). Der Ruhedruck beträgt ~1 kPa bei der Frau und ~2 kPa beim Mann.| Sympathische (α1-adrenerge) Anregung des m. sphincter vesicae internus trägt wesentlich zur Blasenkontinenz bei |
 getriggert wird, zeigt sich der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung.
getriggert wird, zeigt sich der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung.  ). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang
auf. Ab hier
(mit ~1-2 kPa passivem Druck) beginnt
der Blaseninnendruck bei weiterer Füllung nichtlinear zu
steigen, der Harndrang wird bei über 0.5 l Blaseninhalt schmerzhaft;
jedoch gibt es eine beträchtliche Anpassungsfähigkeit durch Zunahme der
Volumendehnbarkeit (Plastizität: die Blase
kann im Extremfall ein Maximalvolumen von ~1,5 Liter fassen).
). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang
auf. Ab hier
(mit ~1-2 kPa passivem Druck) beginnt
der Blaseninnendruck bei weiterer Füllung nichtlinear zu
steigen, der Harndrang wird bei über 0.5 l Blaseninhalt schmerzhaft;
jedoch gibt es eine beträchtliche Anpassungsfähigkeit durch Zunahme der
Volumendehnbarkeit (Plastizität: die Blase
kann im Extremfall ein Maximalvolumen von ~1,5 Liter fassen). Abbildung):
Abbildung):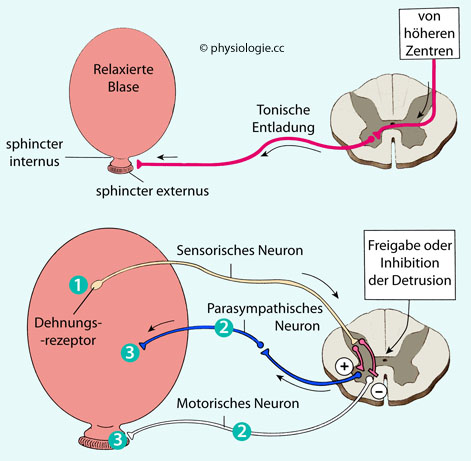
 Abbildung: Kontrolle der Blasentätigkeit
Abbildung: Kontrolle der Blasentätigkeit
 Zur Blasenkontrolle s. auch dort
Zur Blasenkontrolle s. auch dort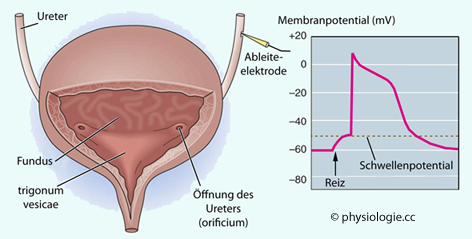
 Abbildung: Aktionspotential einer glatten Muskelzelle im Ureter
Abbildung: Aktionspotential einer glatten Muskelzelle im Ureter Auf Hirnstammebene werden die
Erfordernisse bezüglich Speicherung / Entleerung der Blase mit dem
Status im Vegetativum und der Umgebungssituation abgestimmt und -
situationsbedingt - der Wechsel zwischen Zurückhalten des Harns
einerseits und Freigabe der Detrusion andererseits (phase switching)
vorgenommen.
Auf Hirnstammebene werden die
Erfordernisse bezüglich Speicherung / Entleerung der Blase mit dem
Status im Vegetativum und der Umgebungssituation abgestimmt und -
situationsbedingt - der Wechsel zwischen Zurückhalten des Harns
einerseits und Freigabe der Detrusion andererseits (phase switching)
vorgenommen. Abbildung).
Abbildung).
 Abbildung: Zeitverlauf von Detrusordruck und Harnströmung während einer Blasenentleerung
Abbildung: Zeitverlauf von Detrusordruck und Harnströmung während einer Blasenentleerung
 Der Begriff Urodynamik bezieht sich auf die Untersuchung des unteren Harntrakrs und stützt sich vor allem auf Uroflowmetrie (Messung des Harnstroms) und Cystometrie (Messung der kontraktilen Blasenkraft während der Detrusion) - zusammen mit ergänzenden Methoden wie z.B. Elektromyographie.
Der Begriff Urodynamik bezieht sich auf die Untersuchung des unteren Harntrakrs und stützt sich vor allem auf Uroflowmetrie (Messung des Harnstroms) und Cystometrie (Messung der kontraktilen Blasenkraft während der Detrusion) - zusammen mit ergänzenden Methoden wie z.B. Elektromyographie. Abbildung). Reflektorische Anspannung der
Bauchdeckenmuskulatur verstärkt den Extrusionsmechanismus.
Abbildung). Reflektorische Anspannung der
Bauchdeckenmuskulatur verstärkt den Extrusionsmechanismus.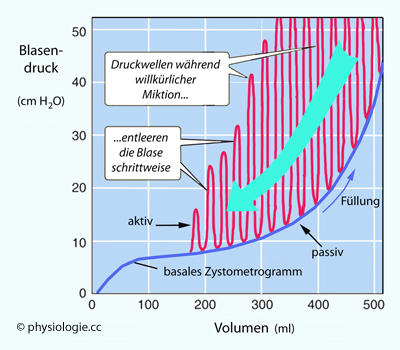
 Abbildung: Druck-Volumen-Diagramm einer Detrusion
Abbildung: Druck-Volumen-Diagramm einer Detrusion

 M. detrusor vesicae: Die Kontraktion des Blasenmuskels wird cholinerg - über muskarinerge Rezeptoren - sowie purinerg (ATP) angeregt.
Die Entleerung der Blase (Miktion, Detrusion
M. detrusor vesicae: Die Kontraktion des Blasenmuskels wird cholinerg - über muskarinerge Rezeptoren - sowie purinerg (ATP) angeregt.
Die Entleerung der Blase (Miktion, Detrusion  ) erfordert ein Umschalten von
sympathischer auf parasympathische Aktivität mit Entspannung des
äußeren Schließmuskels.
) erfordert ein Umschalten von
sympathischer auf parasympathische Aktivität mit Entspannung des
äußeren Schließmuskels. 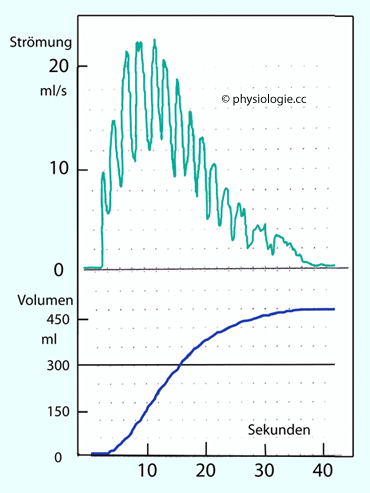
 Abbildung: Zeitprofil von Strömung und Exkretion (gesammeltes Harnvolumen) während einer Detrusion
Abbildung: Zeitprofil von Strömung und Exkretion (gesammeltes Harnvolumen) während einer Detrusion
 Afferenter Teil:
Ausgehend von Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand, über den N. pelvicus - die Rezeptoren
steigern ihre Entladungsfrequenz mit zunehmender Blasenfüllung
Afferenter Teil:
Ausgehend von Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand, über den N. pelvicus - die Rezeptoren
steigern ihre Entladungsfrequenz mit zunehmender Blasenfüllung Reflexzentren
im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale
Ebene) und übergeordnete zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) -
Hirnstamm (Miktionszentrum in der Brücke ventrolateral auf Höhe des
locus coeruleus) und kortikale Gebiete, hier werden perzeptive,
emotionale, vegetative und motorische Aspekte integriert
Reflexzentren
im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale
Ebene) und übergeordnete zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) -
Hirnstamm (Miktionszentrum in der Brücke ventrolateral auf Höhe des
locus coeruleus) und kortikale Gebiete, hier werden perzeptive,
emotionale, vegetative und motorische Aspekte integriert Efferenter Teil mit vegetativ-motorischen und somatomotorischen Anteilen:
Efferenter Teil mit vegetativ-motorischen und somatomotorischen Anteilen:  vom sympathischen Lendengebiet über den N. hypogastricus (Hemmung des Detrusor, Anregung des sphincter internus → unwillkürlicher Harnverhalt)
vom sympathischen Lendengebiet über den N. hypogastricus (Hemmung des Detrusor, Anregung des sphincter internus → unwillkürlicher Harnverhalt) vom
parasympathischen Sakralzentrum über Äste der Nn. splanchnici pelvini (Kontraktion des Detrusor → Blasenentleerung)
vom
parasympathischen Sakralzentrum über Äste der Nn. splanchnici pelvini (Kontraktion des Detrusor → Blasenentleerung) somatomotorische Efferenzen (aus dem Onuf'schen Kern) über den N. pudendus (Kontraktion des sphincter externus → willkürlicher Harnverhalt
somatomotorische Efferenzen (aus dem Onuf'schen Kern) über den N. pudendus (Kontraktion des sphincter externus → willkürlicher Harnverhalt

 Normalerweise
dauert die Entleerung der Harnblase nicht länger als 30 Sekunden
(Durchschnitt ~20 s). Überschreitet die Miktionsdauer diesen Wert, ist
entweder die Blasenmotorik gestört, oder der Ausflusswiderstand ist
erhöht (das kann strukturelle, vorübergehend auch funktionelle Ursachen
haben, insbesondere bei Stresseinfluss).
Normalerweise
dauert die Entleerung der Harnblase nicht länger als 30 Sekunden
(Durchschnitt ~20 s). Überschreitet die Miktionsdauer diesen Wert, ist
entweder die Blasenmotorik gestört, oder der Ausflusswiderstand ist
erhöht (das kann strukturelle, vorübergehend auch funktionelle Ursachen
haben, insbesondere bei Stresseinfluss).  Stressinkontinenz: Bei erschlafftem Beckenboden kann Belastung
(Hebearbeit, Husten,
Niesen..) zu unwillkürlichem Harnverlust führen. Beckenbodenschwäche
und Uterusdescensus sind meist die Ursache (häufige Inkontinenz bei
Frauen). Beckenbodengymnastik und Östrogengabe können helfen.
Stressinkontinenz: Bei erschlafftem Beckenboden kann Belastung
(Hebearbeit, Husten,
Niesen..) zu unwillkürlichem Harnverlust führen. Beckenbodenschwäche
und Uterusdescensus sind meist die Ursache (häufige Inkontinenz bei
Frauen). Beckenbodengymnastik und Östrogengabe können helfen. Obstruktive Abflußhindernisse (z.B.
Prostatahypertrophie, Urethrastrikturen) oder eine atone Blase (z.B.
diabetische Neuropathie) haben eine ständig überfüllte Blase zur Folge
und bedingen Überlaufinkontinenz. Die Blase ist passiv überdehnt, Restharnbildung und Harnträufeln sind die Folge.
Obstruktive Abflußhindernisse (z.B.
Prostatahypertrophie, Urethrastrikturen) oder eine atone Blase (z.B.
diabetische Neuropathie) haben eine ständig überfüllte Blase zur Folge
und bedingen Überlaufinkontinenz. Die Blase ist passiv überdehnt, Restharnbildung und Harnträufeln sind die Folge.  Als Dranginkontinenz bezeichnet man Harndrang mit unfreiwilligem Urinabgang. Motorische
Dranginkontinenz tritt infolge neurologischer Probleme auf
(Schlaganfall, Mb. Parkinson), das Gefühl für die Blase ist erhalten. Sensorische Dranginkontinenz kann z.B. bei Blasenentzündung auftreten - mit der Folge ständigen Harndrangs.
Als Dranginkontinenz bezeichnet man Harndrang mit unfreiwilligem Urinabgang. Motorische
Dranginkontinenz tritt infolge neurologischer Probleme auf
(Schlaganfall, Mb. Parkinson), das Gefühl für die Blase ist erhalten. Sensorische Dranginkontinenz kann z.B. bei Blasenentzündung auftreten - mit der Folge ständigen Harndrangs. Erfolgt eine Blasenentleerung wegen äußerer Umstände bei intakter Blasenfunktion, spricht man von funktioneller Inkontinenz.
Erfolgt eine Blasenentleerung wegen äußerer Umstände bei intakter Blasenfunktion, spricht man von funktioneller Inkontinenz. Uroflowmetrie - Urologische
Diagnostik
Uroflowmetrie - Urologische
Diagnostik

 Das Nierenbecken hat 5-10 ml, die Harnblase ~300 ml Fassungsvermögen; der Ureter transportiert Urin und verhindert Reflux (drucksensitive Pumpe, aktives Ventil) - angetrieben von einer Schrittmacherzone mit spontanaktiven Myozyten. Der renale hydrostatische Druck (~2 kPa) hält Nephrone und Nierenbecken entfaltet, ohne die Filtration zu behindern. Druckanstieg triggert 2-6 peristaltische Kontraktionswellen pro Minute, die über gap junctions mit 2-6 cm/s fortgeleitet werden und Druckspitzen bis zu 8 kPa generieren; höhere Druckgradienten können nicht überwunden werden (vesiko-ureterer Reflux, erschwerte Harnbildung). Die Ureterperistaltik wird cholinerg (parasympathisch) sowie α-adrenerg
angeregt, ß-adrenerg gehemmt. Sensorische Fasern können Schmerz leiten
und bei starker Dehnung des Harnleiters zu Nierenkolik führen Das Nierenbecken hat 5-10 ml, die Harnblase ~300 ml Fassungsvermögen; der Ureter transportiert Urin und verhindert Reflux (drucksensitive Pumpe, aktives Ventil) - angetrieben von einer Schrittmacherzone mit spontanaktiven Myozyten. Der renale hydrostatische Druck (~2 kPa) hält Nephrone und Nierenbecken entfaltet, ohne die Filtration zu behindern. Druckanstieg triggert 2-6 peristaltische Kontraktionswellen pro Minute, die über gap junctions mit 2-6 cm/s fortgeleitet werden und Druckspitzen bis zu 8 kPa generieren; höhere Druckgradienten können nicht überwunden werden (vesiko-ureterer Reflux, erschwerte Harnbildung). Die Ureterperistaltik wird cholinerg (parasympathisch) sowie α-adrenerg
angeregt, ß-adrenerg gehemmt. Sensorische Fasern können Schmerz leiten
und bei starker Dehnung des Harnleiters zu Nierenkolik führen Die
Compliance (∂V/∂p) der Harnblase ist abhängig vom Zeitverlauf der Füllung und dem Zustand der Blasenwand: Bei Erhöhung des Blasenvolumens gibt die Wand plastisch nach (Wanddicke der leeren Blase 5-7 mm, bei maximaler Füllung ~2 mm), der Blasendruck (~1 kPa bei der Frau, ~2 kPa beim Mann) erhöht sich kaum. Der N. pelvicus leitet Afferenzen aus der Blase zum ZNS; bis zu dem Punkt, an dem die Detrusion getriggert wird, ist der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung. Die Kontinenz
(Dichtigkeit: hoher Strömungswiderstand) der Blase ist durch Kontraktion der Sphinkteren am
Blasenausgang und in der Wand der Harnröhre gewährleistet. Der
glattmuskuläre m. sphincter vesicae internus wird α1-adrenerg
angeregt, der quergestreifte äußere Sphinkter durch den Pudendusnerv
(Ursprung im Sakralmark); der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt. Das "Kontinenzzentrum" in der Brücke aktiviert motorische Fasern im N. pudendus und dadurch den äußeren Schließmuskel Die
Compliance (∂V/∂p) der Harnblase ist abhängig vom Zeitverlauf der Füllung und dem Zustand der Blasenwand: Bei Erhöhung des Blasenvolumens gibt die Wand plastisch nach (Wanddicke der leeren Blase 5-7 mm, bei maximaler Füllung ~2 mm), der Blasendruck (~1 kPa bei der Frau, ~2 kPa beim Mann) erhöht sich kaum. Der N. pelvicus leitet Afferenzen aus der Blase zum ZNS; bis zu dem Punkt, an dem die Detrusion getriggert wird, ist der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung. Die Kontinenz
(Dichtigkeit: hoher Strömungswiderstand) der Blase ist durch Kontraktion der Sphinkteren am
Blasenausgang und in der Wand der Harnröhre gewährleistet. Der
glattmuskuläre m. sphincter vesicae internus wird α1-adrenerg
angeregt, der quergestreifte äußere Sphinkter durch den Pudendusnerv
(Ursprung im Sakralmark); der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt. Das "Kontinenzzentrum" in der Brücke aktiviert motorische Fasern im N. pudendus und dadurch den äußeren Schließmuskel Ab ~0,2 Liter
Blaseninhalt werden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand gereizt
(früher bei rascher Füllung). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang auf, der
Blaseninnendruck beginnt mit weiterem Volumen exponentiell zu steigen (bei über 0.5 l
schmerzhaft); im Extremfall kann die Blase mehr als 1 l fassen). Der Hirnstamm
(pontines Blasenzentrum, zentrales Höhlengrau) integriert
Information aus Blase und Harnwegen mit
Impulsen aus höheren Zentren (präfrontaler Kortex, Insel, vorderer gyrus
cinguli). Hemmung
sympathischer Impulse im Thorakolumbalmark (Disinhibition des
Detrusors) und parasympathische Efferenzen regen den Detrusor an. Hoher Druckgradient kombiniert mit
geringem Strömungswiderstand ermöglicht die Entleerung der Blase (Detrusion). Die Kontraktion des Blasenmuskels (m. detrusor vesicae) wird muskarinerg-cholinerg und purinerg (ATP) angeregt. Detrusion hemmt sympathische
Impulse und führt nitriderg zu Erschlaffung der Sphinkterzone
(Reduktion des Fließwiderstandes). Wiederholte
Kontraktionswellen (reflektorisch selbstregenerierend) haben
Druckspitzen bis ~8 kPa, deren Amplitude mit abnehmendem Blasenvolumen
geringer wird Ab ~0,2 Liter
Blaseninhalt werden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand gereizt
(früher bei rascher Füllung). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang auf, der
Blaseninnendruck beginnt mit weiterem Volumen exponentiell zu steigen (bei über 0.5 l
schmerzhaft); im Extremfall kann die Blase mehr als 1 l fassen). Der Hirnstamm
(pontines Blasenzentrum, zentrales Höhlengrau) integriert
Information aus Blase und Harnwegen mit
Impulsen aus höheren Zentren (präfrontaler Kortex, Insel, vorderer gyrus
cinguli). Hemmung
sympathischer Impulse im Thorakolumbalmark (Disinhibition des
Detrusors) und parasympathische Efferenzen regen den Detrusor an. Hoher Druckgradient kombiniert mit
geringem Strömungswiderstand ermöglicht die Entleerung der Blase (Detrusion). Die Kontraktion des Blasenmuskels (m. detrusor vesicae) wird muskarinerg-cholinerg und purinerg (ATP) angeregt. Detrusion hemmt sympathische
Impulse und führt nitriderg zu Erschlaffung der Sphinkterzone
(Reduktion des Fließwiderstandes). Wiederholte
Kontraktionswellen (reflektorisch selbstregenerierend) haben
Druckspitzen bis ~8 kPa, deren Amplitude mit abnehmendem Blasenvolumen
geringer wird Die unteren
Harnwege sind mit Bakterien besiedelt, Blasenharn ist praktisch steril
(Harnfluss, immunologische Schutzmechanismen); Harnverhaltung
begünstigt Infektionen Die unteren
Harnwege sind mit Bakterien besiedelt, Blasenharn ist praktisch steril
(Harnfluss, immunologische Schutzmechanismen); Harnverhaltung
begünstigt Infektionen |
