Physiologie lernen - den Organismus verstehen
 Wie funktioniert der menschliche Körper?
Wie funktioniert der menschliche Körper?

VIII.  Nierenfunktion und ableitende Harnwege
Nierenfunktion und ableitende Harnwege  X.
X.
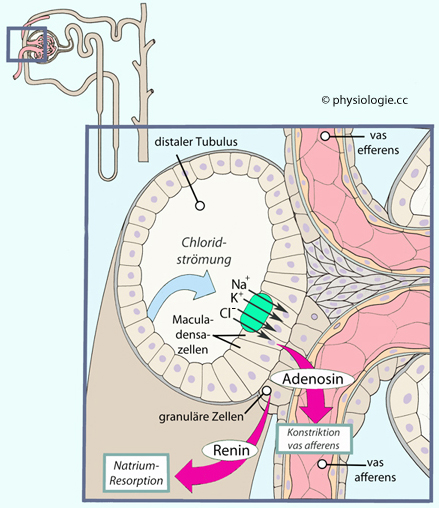 Die
Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und
enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,
produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie
werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung
der Nierenfunktion verändert zahlreiche
Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das
Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales
klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.
Die
Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und
enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,
produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie
werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung
der Nierenfunktion verändert zahlreiche
Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das
Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales
klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.

Renale Funktionen betreffen nicht nur die Ausscheidung von
Stoffwechselendprodukten (Harnstoff und Ammoniumionen als Abbauprodukte von Aminosäuren,
Kreatinin aus dem Muskelstoffwechsel, Harnsäure aus dem
Nukleinsäurestoffwechsel) und Salzen (Kalium, Natrium, Chlorid ..),
sondern auch
Säure-Basen-Haushalt, Wasserausscheidung und Osmolarität, Blutbildung,
Blutdruck und Blutvolumen. Zur Erfüllung der Ausscheidungsfunktionen
ist eine hohe Durchblutung der Nieren nötig, sie beträgt
bei erwachsenen Personen etwa 1 l/min und ist über einen weiten Blutdruckbereich recht konstant (Autoregulation der renalen Perfusion).

Die Entstehung des Harns beginnt im Anfangsteil des Nephrons, dem Nierenkörperchen mit seinem Glomerulum; ein kapillärer Blutdruck von mehr als 50 mmHg bedingt die Filtration
von bis zu 200 Litern "Primärharn" pro Tag. Dieser enthält alle
mikromolekularen Bestandteile des Blutplasmas, die meisten von ihnen
werden anschließend vom Tubulus rückresorbiert und gelangen wieder ins
Blut. Das gilt auch für ~99% des filtrierten Wassers, und so bleiben 1-2 Liter Harn pro Tag zurück - mit in ihm angereicherten
Stoffen, die nicht im selben Maß wie Wasser rückresorbiert, oder auch
zusätzlich tubulär sezerniert werden.

Der hohe Grad
der Rückresorption filtrierter Flüssigkeit ermöglicht die automatische
Konzentrierung von Stoffen, die in den Tubuli nicht rückresorbiert
werden (wie das pflanzliche
Kohlenhydrat Inulin) oder weil sie nur schwach wiederaufgenommen
werden. Wird die Substanz gar nicht resorbiert, entspricht ihre Clearance der glomerulär filtrierten Flüssigkeitsmenge (GFR: glomerular filtration rate).
Als Clearance bezeichnet man die von einem Stoff in einer bestimmten
Zeit (z.B. pro Minute) befreite ("gereinigte") Flüssigkeitsmenge (Volumen / Zeit).

Die proximalen Tubuli
tragen
die Hauptlast der Rückresorption; sie holen z.B. Kalium und Glukose zur
Gänze aus dem Primärharn zurück, zudem Aminosäuren, die meisten
Mineralstoffe, und den Großteil des glomerulär filtrierten
Flüssigkeitsvolumens. Hormonelle Feinabstimmungen (Parathormon, Calcitonin) regeln das Ausmaß der Resorption von Calcium und Phosphat.

Im Nierenmark
baut sich eine (bis 5-fach) hyperosmolare Zone auf, das hilft u.a. bei
der Rückresorption von Wasser. Hohe osmotische Konzentration im
Nierenmark wird durch das Gegenstromprinzip energiesparend aufrechterhalten: Kochsalz wird aus dem
(wasserundurchlässigen) aufsteigenden Schenkel der Henle-Schleife
gepumpt (aktiv), die Tubulusflüssigkeit wird immer salzärmer und
gelangt schließlich hypoton in die Rindenzone zurück. Wasser wandert
aus dem absteigenden Schenkel der Henle-Schleife ins Interstitium, im
Mark baut sich entlang der Tubuli ein Konzentrationsgradient auf.
Dieser erleichtert eine allfällig notwendige (z.B. Durstzustand) rasche
Wasseraufnahme aus den Sammelrohren.

Aus dem spätdistalen und Sammelrohrsystem
kann Wasser rückresorbiert werden, gesteuert vom Gehirn
(hypothalamisch-hypophysär) über Vasopressin (antidiuretisches Hormon, "Wassersparhormon"). Auch Harnstoff wandert teils zurück in das
Nierenmark und beteiligt sich an der osmotischen Dynamik
(Harnstoffmechanismus).

Die Steuerung der Blase
erfolgt im Zusammenspiel von Großhirn, Brücke (pontines
Miktionszentrum) und Rückenmark - somatisch, sympathisch und
parasympathisch. Der Miktionsreflex geht von Dehnungsrezeptoren in der
Blasenwand aus und mündet in einer Anregung der Blasenmuskulatur (m.
detrusor vesicae) sowie Erschlaffung des Ausflußtrichters.
© H. Hinghofer-Szalkay
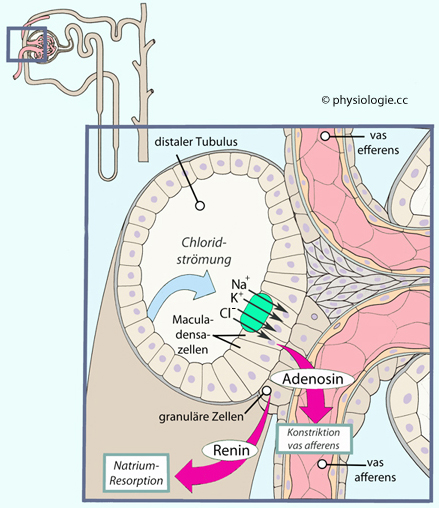 Die
Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und
enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,
produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie
werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung
der Nierenfunktion verändert zahlreiche
Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das
Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales
klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.
Die
Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und
enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,
produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie
werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung
der Nierenfunktion verändert zahlreiche
Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das
Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales
klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.





