

Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Körperhaltung und Motorik



 Elektroencephalogramm: ἤλεκτρον = Bernstein (erste Beobachtung von Elektrizität), ἐγκέφαλον = Gehirn, γραφή = Aufzeichnung
Elektroencephalogramm: ἤλεκτρον = Bernstein (erste Beobachtung von Elektrizität), ἐγκέφαλον = Gehirn, γραφή = Aufzeichnung| Die
Motorik wird auf verschiedenen Funktionsebenen überprüft; die Testung
des Muskeltonus sowie einfacher Reflexe (z.B. Patellarsehnenreflex)
gehören zum Grundrepertoire (Reflexhammer des Neurologen). Muskeltätigkeit bringt Veränderungen im Stoffwechsel mit sich; bei Überschreitung der anaeroben Schwelle nimmt der Lactatspiegel im Blut zu (Lactatschwelle) und bewirkt nicht-respiratorische Azidose. Motorische Efferenzen lassen sich überprüfen, indem die Ankunftszeit der Erregung am Muskel nach Reizung des motorischen Cortex gemessen wird. Ein Elektromyogramm ist die Ableitung motorischer Potentiale aus einem Muskel (invasiv durch Einstech-, nichtinvasiv über Hautelektroden). Je stärker die Aktivierung, desto mehr motorische Einheiten senden - mit zunehmender Frequenz - ein- bis dreiphasige Entladunspotentiale. Bei hoher Aktivierungsstärke verschmelzen diese zu einem Interferenzmuster. Untersuchungen der motorischen Planung und Kontrolle im Großhirn kann mit verschiedenen Methoden erfolgen (EEG mit Untersuchung prämotorischer Potentiale, Magneto-Enzephalographie, verschiedene bildgebende Verfahren). |
 Stoffwechsel
Stoffwechsel  T- und H-Reflex, M-Welle und H-Welle
T- und H-Reflex, M-Welle und H-Welle  Prämotorische Potentiale
Prämotorische Potentiale  Transkranielle Magnetstimulation
Transkranielle Magnetstimulation  Elektromyographie
Elektromyographie Muskeltonus
Muskeltonus
 Core messages
Core messages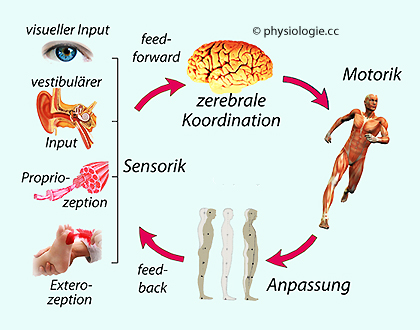
 Abbildung: Sensorisch-zerebrale Koordination der Motorik
Abbildung: Sensorisch-zerebrale Koordination der Motorik
 Als Muskeltonus bezeichnet man den 'plastischen' Dehnungswiderstand
willkürlich entspannter Muskulatur.
Man prüft ihn durch passives Hin- und Herbewegen in den Gelenken
(tonischer Dehnungsreflex) und beurteilt den unwillkürlichen Muskelwiderstand
Als Muskeltonus bezeichnet man den 'plastischen' Dehnungswiderstand
willkürlich entspannter Muskulatur.
Man prüft ihn durch passives Hin- und Herbewegen in den Gelenken
(tonischer Dehnungsreflex) und beurteilt den unwillkürlichen Muskelwiderstand an der Nacken- und Halsmuskulatur
durch Hochheben des Kopfes oder durch den 'Kopffalltest'
an der Nacken- und Halsmuskulatur
durch Hochheben des Kopfes oder durch den 'Kopffalltest' an der Muskulatur der Arme durch Beugen und Strecken im Schulter- und Ellbogengelenk
(evt. Händeschütteln)
an der Muskulatur der Arme durch Beugen und Strecken im Schulter- und Ellbogengelenk
(evt. Händeschütteln) an der Muskulatur der Beine durch Beugen und Strecken im Hüft- und Kniegelenk.
an der Muskulatur der Beine durch Beugen und Strecken im Hüft- und Kniegelenk. Seitenvergleiche und
Seitenvergleiche und Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit.
Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit. Bleibt man unterhalb der Dauerleistungsgrenze, kann die Leistung lange
und ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz - auf einem steady state - fortgeführt werden.
Bleibt man unterhalb der Dauerleistungsgrenze, kann die Leistung lange
und ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz - auf einem steady state - fortgeführt werden. Wird die Dauerleistungsgrenze überschritten, ist die Leistung ermüdend und die Pulsfrequenz nimmt stetig zu, ohne sich zu stabilisieren (Ermüdungsanstieg).
Wird die Dauerleistungsgrenze überschritten, ist die Leistung ermüdend und die Pulsfrequenz nimmt stetig zu, ohne sich zu stabilisieren (Ermüdungsanstieg).
 Abbildung: Auslösung des "Patellarsehnenreflexes"
Abbildung: Auslösung des "Patellarsehnenreflexes"
 mechanische Dehnung: Dehnreflex (myostatic reflex, stretch reflex, tendon jerk reflex), z.B. als Patellarsehnen- (
mechanische Dehnung: Dehnreflex (myostatic reflex, stretch reflex, tendon jerk reflex), z.B. als Patellarsehnen- ( Abbildung),
Achillessehnen-, Masseter- (jaw jerk), Brachioradialis-Reflex; irreführenderweise als "Sehnen"- oder T-Reflex - T nach tendon - bezeichnet, wenn durch Dehnung des Muskels über seine Sehne ausgelöst.
Abbildung),
Achillessehnen-, Masseter- (jaw jerk), Brachioradialis-Reflex; irreführenderweise als "Sehnen"- oder T-Reflex - T nach tendon - bezeichnet, wenn durch Dehnung des Muskels über seine Sehne ausgelöst.
 elektrische Reizung (H-Reflex
elektrische Reizung (H-Reflex  ).
Elektrische Reizung von Fasern
in einem Nerven, der den zu
prüfenden Muskel versorgt, führt zur Auslösung des spinalen
Spindelreflexes. In diesem Fall wird - im Gegensatz zum
T-Reflex - die Muskelspindel umgangen.
).
Elektrische Reizung von Fasern
in einem Nerven, der den zu
prüfenden Muskel versorgt, führt zur Auslösung des spinalen
Spindelreflexes. In diesem Fall wird - im Gegensatz zum
T-Reflex - die Muskelspindel umgangen. | Geringe Stromstärken erregen bei der Auslösung des H-Reflexes nur afferente Fasern |
 Mehr zum EEG s. dort
Mehr zum EEG s. dort Solche Fragen wurden u.a. durch Ableitung zerebraler Bereitschaftspotentiale
untersucht (Libet-Versuch, s. unten). Diese treten bilateral
früher als 0,2 Sekunden vor
Bewegungsbeginn auf - umso früher und intensiver, je komplexer die
geplante Bewegung ist. Inwieweit ein "freier Wille" der Handlungen
besteht, ist einerseits eine Frage der Definition, andererseits eine
Problematik, die über die Neurophysiologie hinausreicht und nach wie
vor in Diskussion ist.
Solche Fragen wurden u.a. durch Ableitung zerebraler Bereitschaftspotentiale
untersucht (Libet-Versuch, s. unten). Diese treten bilateral
früher als 0,2 Sekunden vor
Bewegungsbeginn auf - umso früher und intensiver, je komplexer die
geplante Bewegung ist. Inwieweit ein "freier Wille" der Handlungen
besteht, ist einerseits eine Frage der Definition, andererseits eine
Problematik, die über die Neurophysiologie hinausreicht und nach wie
vor in Diskussion ist.
 Abbildung: Bereitschaftspotential im EEG
Abbildung: Bereitschaftspotential im EEG steigt das gemittelte Bereitschaftspotential an, bevor die Handlungsabsicht bewusst wird
steigt das gemittelte Bereitschaftspotential an, bevor die Handlungsabsicht bewusst wird
| Bereitschaftspotentiale treten immer über beiden Hemisphären auf |
 s. dort).
s. dort).
 Abbildung: Wundt'sche Uhr
Abbildung: Wundt'sche Uhr 

 sollte darauf eine Antwort geben: Der Proband sitzt vor einen Bildschirm, auf dem sich ein Lichtpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 360° in 2,5 sec im Kreis bewegt (sog.
Wundt’sche Uhr,
sollte darauf eine Antwort geben: Der Proband sitzt vor einen Bildschirm, auf dem sich ein Lichtpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 360° in 2,5 sec im Kreis bewegt (sog.
Wundt’sche Uhr,  Abbildung). Die Person führt zu einem
beliebigen Zeitpunkt eine Bewegung aus und gibt den Moment, in welchem
er sich für die Bewegung entscheidet, durch Angabe des Winkels des
Lichtpunktes an.
Abbildung). Die Person führt zu einem
beliebigen Zeitpunkt eine Bewegung aus und gibt den Moment, in welchem
er sich für die Bewegung entscheidet, durch Angabe des Winkels des
Lichtpunktes an.  Abbildung), des
Bewusstwerdens einer Bewegungsabsicht, und des
Beginns der Bewegung verglichen. Der Libet-Versuch suggeriert, dass (unter
diesen experimentellen Bedingungen) die Bewegung bewusst erst "gewollt"
wird, wenn das Gehirn bereits unbewusst die Intention zu dieser
motorischen Aktion "vorbereitet" hat.
Abbildung), des
Bewusstwerdens einer Bewegungsabsicht, und des
Beginns der Bewegung verglichen. Der Libet-Versuch suggeriert, dass (unter
diesen experimentellen Bedingungen) die Bewegung bewusst erst "gewollt"
wird, wenn das Gehirn bereits unbewusst die Intention zu dieser
motorischen Aktion "vorbereitet" hat.  Schon John Locke (17. Jh.) zweifelte das Konzept des freien Willens an. Das Bereitschaftspotential wurde 1964 von Lüder Deecke und Hans Kornhuber
beschrieben. Dass das Bereitschaftspotential vor der Bewusstwerdung
einer Handlungsintention erfolgt, wurde von Benjamin Libet 1983 gezeigt
(s. oben). Die Fähigkeit des Gehirns, eine im Gange befindliche
Handlung noch zu "beeinspruchen", wurde 2007 von Patrick Haggard
nachgewiesen, und 2010 wurde klar, dass das Bereitschaftspotential
unabhängig davon auftritt, welche Entscheidung letztendlich getroffen
wird.
Schon John Locke (17. Jh.) zweifelte das Konzept des freien Willens an. Das Bereitschaftspotential wurde 1964 von Lüder Deecke und Hans Kornhuber
beschrieben. Dass das Bereitschaftspotential vor der Bewusstwerdung
einer Handlungsintention erfolgt, wurde von Benjamin Libet 1983 gezeigt
(s. oben). Die Fähigkeit des Gehirns, eine im Gange befindliche
Handlung noch zu "beeinspruchen", wurde 2007 von Patrick Haggard
nachgewiesen, und 2010 wurde klar, dass das Bereitschaftspotential
unabhängig davon auftritt, welche Entscheidung letztendlich getroffen
wird. Abbildung oben: Libet-Versuch).
Abbildung oben: Libet-Versuch).
 Abbildung: Transkranielle magnetische Stimulation des motorischen Cortex
Abbildung: Transkranielle magnetische Stimulation des motorischen Cortex
 Abbildung) ermittelt werden.
Abbildung) ermittelt werden. (EMG) kann man z.B. in Sportphysiologie bzw. Bewegungswissenschaften die
Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ablesen. In der
neurologischen Anwendung kann man aus dem EMG diagnostizieren, ob allenfalls eine
(Schädigung von Muskelzellen) oder MyopathieNeuropathie (Schädigung
von Nervenfasern) vorliegt.
(EMG) kann man z.B. in Sportphysiologie bzw. Bewegungswissenschaften die
Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ablesen. In der
neurologischen Anwendung kann man aus dem EMG diagnostizieren, ob allenfalls eine
(Schädigung von Muskelzellen) oder MyopathieNeuropathie (Schädigung
von Nervenfasern) vorliegt. 
 Abbildung: Nichtinvasiver elektromyographischer Versuchsaufbau
Abbildung: Nichtinvasiver elektromyographischer Versuchsaufbau

 Abbildung: Interferenzmuster (rechts oben), Einzelkomplexe (rechts unten)
Abbildung: Interferenzmuster (rechts oben), Einzelkomplexe (rechts unten)
 Abbildung).
Abbildung).
 Abbildung: Motorische Einheiten
Abbildung: Motorische Einheiten
 Elektromyographische Befunde: Bei mäßiger Kontraktion eines Muskels
finden sich im EMG einzelne Entladungsmuster der motorischen Einheiten,
bei maximaler Kontraktion durch Überlagerung mehrerer Aktivitäten - die
nun von zahlreichen Einheiten und hochfrequent auftreten - ein
Interferenzmuster.
Elektromyographische Befunde: Bei mäßiger Kontraktion eines Muskels
finden sich im EMG einzelne Entladungsmuster der motorischen Einheiten,
bei maximaler Kontraktion durch Überlagerung mehrerer Aktivitäten - die
nun von zahlreichen Einheiten und hochfrequent auftreten - ein
Interferenzmuster.  Bei einer myopathischen
Störung, die durch Ausfall einzelner Muskelfasern innerhalb der
motorischen Einheiten gekennzeichnet ist, zeigen sich kurze, kleine und
polyphasische Einzelpotentiale (Entladungen der motorischen Einheiten)
und ein niederamplitudiges, dichtes Interferenzmuster.
Bei einer myopathischen
Störung, die durch Ausfall einzelner Muskelfasern innerhalb der
motorischen Einheiten gekennzeichnet ist, zeigen sich kurze, kleine und
polyphasische Einzelpotentiale (Entladungen der motorischen Einheiten)
und ein niederamplitudiges, dichtes Interferenzmuster. Neuropathische
Störungen hingegen sind bedingt durch Ausfall ganzer motorischen
Vorderhornzellen und damit motorischen Einheiten. Die verbliebenen,
funktionstüchtigen Einheiten hypertrophieren kompensatorisch; die
Einzelpotentiale im EMG sind groß und verbreitert, das
Interferenzmuster erscheint weniger überlagert (rarefiziert).
Neuropathische
Störungen hingegen sind bedingt durch Ausfall ganzer motorischen
Vorderhornzellen und damit motorischen Einheiten. Die verbliebenen,
funktionstüchtigen Einheiten hypertrophieren kompensatorisch; die
Einzelpotentiale im EMG sind groß und verbreitert, das
Interferenzmuster erscheint weniger überlagert (rarefiziert).
 Abbildung: Elektromyogramme
Abbildung: Elektromyogramme Allgemeines zu elektrophysiologischen Ableitungen s. dort
Allgemeines zu elektrophysiologischen Ableitungen s. dort Zu Prinzipien der Elektrophysiologie s. dort
Zu Prinzipien der Elektrophysiologie s. dort Muskuläre Hypotonie: Untersuchte
Extremität 'liegt schwer in der Hand'; Gelenke überstreckbar;
z.B. bei Polyneuritis, Hinterstrangschäden, Chorea
Muskuläre Hypotonie: Untersuchte
Extremität 'liegt schwer in der Hand'; Gelenke überstreckbar;
z.B. bei Polyneuritis, Hinterstrangschäden, Chorea Schlaffe Lähmung (Plegie
Schlaffe Lähmung (Plegie  , flaccid paralysis): Tonus herabgesetzt
als Zeichen einer Schädigung der Motoneuronen (zentral oder
peripher bedingt)
, flaccid paralysis): Tonus herabgesetzt
als Zeichen einer Schädigung der Motoneuronen (zentral oder
peripher bedingt) Spastische
Spastische  Lähmung: Tonus
erhöht ('federnder' Widerstand, bei zunehmender Dehnung steigend,
mit plötzlichem Nachlassen - 'Taschenmesserphänomen') als
Zeichen einer zentralen Lähmung (Pyramidenbahnzeichen) mit gesteigerten
Eigenreflexmustern
Lähmung: Tonus
erhöht ('federnder' Widerstand, bei zunehmender Dehnung steigend,
mit plötzlichem Nachlassen - 'Taschenmesserphänomen') als
Zeichen einer zentralen Lähmung (Pyramidenbahnzeichen) mit gesteigerten
Eigenreflexmustern Rigor
Rigor  : 'wächserner' Widerstand,
in allen Gelenken Strecker wie Beuger betreffend, im Extremfall als
'Zahnradphänomen' (wiederholtes ruckartiges 'Einrasten') – insbesondere bei Mb. Parkinson
: 'wächserner' Widerstand,
in allen Gelenken Strecker wie Beuger betreffend, im Extremfall als
'Zahnradphänomen' (wiederholtes ruckartiges 'Einrasten') – insbesondere bei Mb. Parkinson  Muskeltonus ist der unwillkürliche Widerstand, den entspannte Muskeln
einem Hin- und Herbewegen in den Gelenken entgegensetzen. Getestet wird
er an Nacken- und Halsmuskeln durch Hochheben des Kopfes oder den
'Kopffalltest', an den Armen durch Beugen und Strecken im Schulter- und
Ellbogengelenk, an den Beinen durch Beugen und Strecken im Hüft- und
Kniegelenk
Muskeltonus ist der unwillkürliche Widerstand, den entspannte Muskeln
einem Hin- und Herbewegen in den Gelenken entgegensetzen. Getestet wird
er an Nacken- und Halsmuskeln durch Hochheben des Kopfes oder den
'Kopffalltest', an den Armen durch Beugen und Strecken im Schulter- und
Ellbogengelenk, an den Beinen durch Beugen und Strecken im Hüft- und
Kniegelenk Die Dauerleistungsgrenze äußert sich in der Belastbarkeit der
Muskulatur für längere Arbeit. Unterhalb der Dauerleistungsgrenze kann
die Leistung ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz über längere Zeit
erbracht werden (Höchstwert 100-130 bpm); darüber - ab einem Lactatspiegel von 2,2 mM/l - nimmt die Pulsfrequenz stetig zu
(Ermüdungsanstieg)
Die Dauerleistungsgrenze äußert sich in der Belastbarkeit der
Muskulatur für längere Arbeit. Unterhalb der Dauerleistungsgrenze kann
die Leistung ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz über längere Zeit
erbracht werden (Höchstwert 100-130 bpm); darüber - ab einem Lactatspiegel von 2,2 mM/l - nimmt die Pulsfrequenz stetig zu
(Ermüdungsanstieg) Eigenreflexe (Auslösung und Reaktion im selben Muskel - z.B.
Masseterreflex) prüft man durch mechanische Dehnung (T-Reflex) oder
elektrische Reizung (H-Reflex). Geringe Stromstärken erregen bei
letzteren nur afferente Fasern. Bei Fremdreflexen (z.B.
Lidschlussreflex) sind Ausgangs- und Zielorgan nicht identisch
Eigenreflexe (Auslösung und Reaktion im selben Muskel - z.B.
Masseterreflex) prüft man durch mechanische Dehnung (T-Reflex) oder
elektrische Reizung (H-Reflex). Geringe Stromstärken erregen bei
letzteren nur afferente Fasern. Bei Fremdreflexen (z.B.
Lidschlussreflex) sind Ausgangs- und Zielorgan nicht identisch Ereigniskorrelierte Potentiale (EP) sind aus dem EEG-Muster gemittelte
Potentialverläufe, die mit einem Ereignis (motorisch oder sensorisch)
ursächlich zusammenhängen. Bereitschaftspotentiale
sind Ausdruck teils subkortikaler motorischer Vorbereitung (nicht der
Entladung von Pyramidenzellen im primären motorischen Cortex) und
treten etwa eine Sekunde vor Bewegungsbeginn bilateral (über beiden
Hemisphären) auf - umso früher und intensiver, je komplexer die
geplante Bewegung ist
Ereigniskorrelierte Potentiale (EP) sind aus dem EEG-Muster gemittelte
Potentialverläufe, die mit einem Ereignis (motorisch oder sensorisch)
ursächlich zusammenhängen. Bereitschaftspotentiale
sind Ausdruck teils subkortikaler motorischer Vorbereitung (nicht der
Entladung von Pyramidenzellen im primären motorischen Cortex) und
treten etwa eine Sekunde vor Bewegungsbeginn bilateral (über beiden
Hemisphären) auf - umso früher und intensiver, je komplexer die
geplante Bewegung ist Transkranielle magnetische Stimulation (TMS) des motorischen Cortex -
eventuell repetitiv (rTMS) - dient zur Testung der motorischen Leitung
(Kriterien: Zeit bis zur Ankunft der Potentiale am Muskel, Gestalt der
motorischen Signale)
Transkranielle magnetische Stimulation (TMS) des motorischen Cortex -
eventuell repetitiv (rTMS) - dient zur Testung der motorischen Leitung
(Kriterien: Zeit bis zur Ankunft der Potentiale am Muskel, Gestalt der
motorischen Signale) Elektromyographie (EMG) leitet elektrische Signale während
Muskelkontraktionen ab. Die Zahl aktivierter motorischer Einheiten -
und ihre Entladungsfrequenz - steigt mit zunehmender Anregung aus dem
ZNS. Die abgeleiteten Aktionspotentiale zeigen die Aktivität einer
räumlich begrenzten Gruppe von Fasern, die zu 1-3 motorischen Einheiten
gehören. Bei stärkerer Aktivierung sind keine Einzelkomplexe mehr
erkennbar (Interferenzmuster)
Elektromyographie (EMG) leitet elektrische Signale während
Muskelkontraktionen ab. Die Zahl aktivierter motorischer Einheiten -
und ihre Entladungsfrequenz - steigt mit zunehmender Anregung aus dem
ZNS. Die abgeleiteten Aktionspotentiale zeigen die Aktivität einer
räumlich begrenzten Gruppe von Fasern, die zu 1-3 motorischen Einheiten
gehören. Bei stärkerer Aktivierung sind keine Einzelkomplexe mehr
erkennbar (Interferenzmuster) |
