




| Der Hirnstamm (Brücke und Mittelhirn) hilft bei der Erhaltung des Gleichgewichts.
Er empfängt Information von Otolithen- und Bogengangsrezeptoren im
Innenohr sowie von der Tiefensensibilität im Körper. In enger
Kooperation mit
dem Kleinhirn steuert der Hirnstamm Augenmuskel- und
Extrapyramidalmotorik. Dabei verrechnet er absteigende Impulse von
Basalganglien und
motorischen Rindengebieten. Eigene Kerngebiete (nucleus ruber, formatio reticularis) haben - wie die Vestibulariskerne - Zugang zu motorischen Vorderhornzellen bzw. diesen vorgeschalteten Interneuronen. Statomotorische Reflexe stabilisieren die Körperhaltung (Haltereflexe), die Justierung von Kopf und Körper erfolgt über Stellreflexe. Zahlreiche weitere, zum Teil lebenswichtige Reflexe haben ihr Zentrum im Hirnstamm: Kornealreflex und Konjunktivalreflex (Lidschluss, Tränensekretion, Kontraktion des Orbikularmuskels, Zurückweichen des Kopfes) Niesreflex (Einatmung, Verschluss der Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur, plötzliches Öffnen der Glottis) Hustenreflex (Reinigung der Atemwege) Kauen ("Kaumustergenerator"), Salivationsreflex, Schluckmotorik (beteiligte Hirnnerven: V, VII, IX, X, XI, XII) Brechreflex, Würgreflex (Pharyngealreflex). Weiters beinhaltet der Hirnstamm Zentren für die Steuerung von Atmung und Kreislauf und beteiligt sich an der Schlafsteuerung. |
 Halte- und Stellreflexe
Halte- und Stellreflexe  Weitere Hirnstammreflexe
Weitere Hirnstammreflexe
 Kontrolle der Haltung über das gesamte ZNS
Kontrolle der Haltung über das gesamte ZNS
 Core messages
Core messages Über Reflexe allgemein s. dort
Über Reflexe allgemein s. dort
 Abbildung: Stellreflex bei einer Katze
Abbildung: Stellreflex bei einer Katze
 Abbildung). Wie
intensiv muss dabei das ZNS in die Steuerung einzelner Muskeln
eingebunden sein? Können Aufgaben an
untergeordnete Zentren delegiert werden, während sich das Großhirn mit
"strategischen" Fragen der Motorik beschäftigt?
Abbildung). Wie
intensiv muss dabei das ZNS in die Steuerung einzelner Muskeln
eingebunden sein? Können Aufgaben an
untergeordnete Zentren delegiert werden, während sich das Großhirn mit
"strategischen" Fragen der Motorik beschäftigt? 
 Abbildung: Ebenen der motorischen Kontrolle
Abbildung: Ebenen der motorischen Kontrolle dPM, dorsaler prämotorischer Cortex
dPM, dorsaler prämotorischer Cortex  SMA, supplementärmotorisches Areal der Großhirnrinde
SMA, supplementärmotorisches Areal der Großhirnrinde

 Der nucleus
ruber (red nucleus) des Mittelhirns erhält viele Zuflüsse von
Großhirn, Basalganglien und Kleinhirn, und entsendet den tractus
rubrospinalis zu motorischen Vorderhornzellen im Rückenmark.
Gleichzeitig sendet er Impulse über den Olivenkern zum nucleus dentatus
des Kleinhirns. Insgesamt wird so motorisch relevante neuronale
Information in Wechselwirkung der genannten Kerngebiete abgeglichen und
präzisiert.
Der nucleus
ruber (red nucleus) des Mittelhirns erhält viele Zuflüsse von
Großhirn, Basalganglien und Kleinhirn, und entsendet den tractus
rubrospinalis zu motorischen Vorderhornzellen im Rückenmark.
Gleichzeitig sendet er Impulse über den Olivenkern zum nucleus dentatus
des Kleinhirns. Insgesamt wird so motorisch relevante neuronale
Information in Wechselwirkung der genannten Kerngebiete abgeglichen und
präzisiert. Der
nucleus ruber bietet eine alternative Route für die Übermittlung von
Signalen aus der motorischen Großhirnrinde (vor allem via den tractus
corticorubralis) an das Rückenmark. Im nucleus ruber sind große Neurone
(ähnlich den Betz'schen Riesenzellen im motorischen Cortex) die
Adressaten dieser Impulse, und diese magnozellulären Neurone
sind der Ursprung des tractus rubrospinalis, dessen Fasern die Seite
kreuzen und in der Seitenregion des Rückenmarks absteigen (s. dort). Hier nehmen sie synaptischen Kontakt vor allem zu Interneuronen auf, einige auch direkt zu motorischen Vorderhornzellen.
Der
nucleus ruber bietet eine alternative Route für die Übermittlung von
Signalen aus der motorischen Großhirnrinde (vor allem via den tractus
corticorubralis) an das Rückenmark. Im nucleus ruber sind große Neurone
(ähnlich den Betz'schen Riesenzellen im motorischen Cortex) die
Adressaten dieser Impulse, und diese magnozellulären Neurone
sind der Ursprung des tractus rubrospinalis, dessen Fasern die Seite
kreuzen und in der Seitenregion des Rückenmarks absteigen (s. dort). Hier nehmen sie synaptischen Kontakt vor allem zu Interneuronen auf, einige auch direkt zu motorischen Vorderhornzellen.
 Abbildung: Hirnstammkerne und ihre Verbindungen
Abbildung: Hirnstammkerne und ihre Verbindungen
 Die formatio
reticularis
(reticular formation) stellt neben den Basalganglien und dem Kleinhirn
eine zentrale subkortikale Struktur der motorischen Kontrolle dar (Stabilisierung der Körperhaltung und Fortbewegung.).
Sie besteht aus zahlreichen Kernen im Bereich des Hirnstamms
(Mittelhirn bis verlängertes Mark) und beeinflusst die Aktivität des γ-motorischen Systems und damit des Muskeltonus.
Die formatio
reticularis
(reticular formation) stellt neben den Basalganglien und dem Kleinhirn
eine zentrale subkortikale Struktur der motorischen Kontrolle dar (Stabilisierung der Körperhaltung und Fortbewegung.).
Sie besteht aus zahlreichen Kernen im Bereich des Hirnstamms
(Mittelhirn bis verlängertes Mark) und beeinflusst die Aktivität des γ-motorischen Systems und damit des Muskeltonus.  Narkotisierte Patienten können die während der Operation auftretenden
Reize nicht bewusst verarbeiten. Die spezifischen Cortex-Gebiete
erhalten allerdings auch während der Narkose Afferenzen über den
Thalamus, die Ausbildung von Engrammen kann auch in diesem Zustand
nicht ganz ausgeschlossen werden.
Narkotisierte Patienten können die während der Operation auftretenden
Reize nicht bewusst verarbeiten. Die spezifischen Cortex-Gebiete
erhalten allerdings auch während der Narkose Afferenzen über den
Thalamus, die Ausbildung von Engrammen kann auch in diesem Zustand
nicht ganz ausgeschlossen werden. Die
Vestibulariskerne (vestibular nuclei) werden vom Gleichgewichtssinn versorgt und stehen mit
dem Urkleinhirn in enger Verbindung. Ihre zum Rückenmark absteigenden
Fasern bilden den tractus vestibulospinalis (
Die
Vestibulariskerne (vestibular nuclei) werden vom Gleichgewichtssinn versorgt und stehen mit
dem Urkleinhirn in enger Verbindung. Ihre zum Rückenmark absteigenden
Fasern bilden den tractus vestibulospinalis ( Abbildung). Dessen lateraler Teil
vermittelt vor allem eine Anregung der Streckmuskeln der Beine, was die
Aufrechterhaltung der Körperhaltung gegen die Schwerkraftwirkung
unterstützt.
Abbildung). Dessen lateraler Teil
vermittelt vor allem eine Anregung der Streckmuskeln der Beine, was die
Aufrechterhaltung der Körperhaltung gegen die Schwerkraftwirkung
unterstützt.
 Das Reflexpaket des
Rückenmarks kann die aufrechte Körperhaltung stabilisieren, soferne
keine Änderung der Situation auftritt; zur Erhaltung der Balance bei
externen Störungen (Bewegung des Untergrundes, Stoß gegen den Körper)
oder bei Kopfdrehung bedarf es supraspinaler Kontrolle. Dabei spielen
Hirnstamm und Kleinhirn (Vestibulo- und Spinozerebellum) eine führende
Rolle, sie beziehen schnelle (formatio reticularis, nuclei
vestibulares) und sehr schnelle Afferenzen (Kleinhirn) aus
Somatosensorik und Gleichgewichtsorgan. Das Kleinhirn dosiert
(begrenzt) dabei die motorischen Impulse zur Erhaltung der
Körperstabilität und speichert entsprechende motorische Erfahrungen.
Das Reflexpaket des
Rückenmarks kann die aufrechte Körperhaltung stabilisieren, soferne
keine Änderung der Situation auftritt; zur Erhaltung der Balance bei
externen Störungen (Bewegung des Untergrundes, Stoß gegen den Körper)
oder bei Kopfdrehung bedarf es supraspinaler Kontrolle. Dabei spielen
Hirnstamm und Kleinhirn (Vestibulo- und Spinozerebellum) eine führende
Rolle, sie beziehen schnelle (formatio reticularis, nuclei
vestibulares) und sehr schnelle Afferenzen (Kleinhirn) aus
Somatosensorik und Gleichgewichtsorgan. Das Kleinhirn dosiert
(begrenzt) dabei die motorischen Impulse zur Erhaltung der
Körperstabilität und speichert entsprechende motorische Erfahrungen.
 Abbildung: Verschaltungen der motorischen Kontrolle
Abbildung: Verschaltungen der motorischen Kontrolle
 Der tractus vestibulospinalis hält einerseits den Kopf während der Fortbewegung balanciert. Die nuclei vestibulares empfangen über den VIII. Hirnnerven aus dem Innenohr entsprechende Information über die Kopfposition (vergleichbar einem Kreiselkompass). Ein anderer Teil fördert den Extensortonus vor allem der Beine, was die aufrechte Körperhaltung unterstützt.
Der tractus vestibulospinalis hält einerseits den Kopf während der Fortbewegung balanciert. Die nuclei vestibulares empfangen über den VIII. Hirnnerven aus dem Innenohr entsprechende Information über die Kopfposition (vergleichbar einem Kreiselkompass). Ein anderer Teil fördert den Extensortonus vor allem der Beine, was die aufrechte Körperhaltung unterstützt. Der tractus tectospinalis wurzelt in den colliculi superiores der Vierhügelplatte, die ihre Impulse einerseits aus der Netzhaut
bezieht, andererseits aus der Sehrinde, sowie Informationen über
Somatosensorik und Gehör. Damit entwerfen die oberen Vierhügel ein
komplexes Bild der Umwelt, was ihnen ermöglicht, präzise zielgerichtete Bewegungen vor allem von Hals- und Schultermuskeln zu generieren.
Der tractus tectospinalis wurzelt in den colliculi superiores der Vierhügelplatte, die ihre Impulse einerseits aus der Netzhaut
bezieht, andererseits aus der Sehrinde, sowie Informationen über
Somatosensorik und Gehör. Damit entwerfen die oberen Vierhügel ein
komplexes Bild der Umwelt, was ihnen ermöglicht, präzise zielgerichtete Bewegungen vor allem von Hals- und Schultermuskeln zu generieren. Halte- (Haltungs-, Steh-) und Stellreflexe (placing reflexes, righting reflexes) werden vom
Gleichgewichtssinn im Innenohr (Vestibularapparat), der Tiefensensibilität im
Halsbereich (Muskelspindeln der Nackenmuskulatur), aber auch visuellen (Photorezeptoren der Netzhaut) und Hautreizen (Berührungsrezeptoren) ausgelöst. Ihre Aufgabe ist das Einstellen und Erhalten der
Orientierung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen in einem Oben-Unten-Bezug,
d.h. bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Schwerefeld der
Erde. Sie ermöglichen eine automatische Justierung des Kopfes und des Körpers.
Halte- (Haltungs-, Steh-) und Stellreflexe (placing reflexes, righting reflexes) werden vom
Gleichgewichtssinn im Innenohr (Vestibularapparat), der Tiefensensibilität im
Halsbereich (Muskelspindeln der Nackenmuskulatur), aber auch visuellen (Photorezeptoren der Netzhaut) und Hautreizen (Berührungsrezeptoren) ausgelöst. Ihre Aufgabe ist das Einstellen und Erhalten der
Orientierung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen in einem Oben-Unten-Bezug,
d.h. bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Schwerefeld der
Erde. Sie ermöglichen eine automatische Justierung des Kopfes und des Körpers.
 Einerseits werden diese Reflexe vom Gleichgewichtsorgan ausgelöst, z.B. bewirkt Schiefstellung des Kopfes eine automatische Korrektur durch die
Halsmuskeln; anschließend folgt der Rumpf nach.
Einerseits werden diese Reflexe vom Gleichgewichtsorgan ausgelöst, z.B. bewirkt Schiefstellung des Kopfes eine automatische Korrektur durch die
Halsmuskeln; anschließend folgt der Rumpf nach.  Andererseits bewirkt
asymmetrische Reizung von Muskelspindeln im Halsbereich entsprechende
Nachstellungen in der Somatomotorik.
Andererseits bewirkt
asymmetrische Reizung von Muskelspindeln im Halsbereich entsprechende
Nachstellungen in der Somatomotorik.
 Der tractus reticulospinalis entspringt in der formatio reticularis der Pons und der Medulla oblongata. Der pontine tractus reticulospinalis fördert Haltereflexe, welche den Körper im Schwerkraftfeld stabilisieren - im Wesentlichen über Anregung der Extensoren der Beine. Der medulläre tractus reticulospinalis hat einen gegenteiligen Effekt: Er verringert die reflektorische Anregung der Streckmuskeln.
Der tractus reticulospinalis entspringt in der formatio reticularis der Pons und der Medulla oblongata. Der pontine tractus reticulospinalis fördert Haltereflexe, welche den Körper im Schwerkraftfeld stabilisieren - im Wesentlichen über Anregung der Extensoren der Beine. Der medulläre tractus reticulospinalis hat einen gegenteiligen Effekt: Er verringert die reflektorische Anregung der Streckmuskeln. Stellreflexe (statomotorische, statokinetische Reflexe)
werden durch äußere Störungen bzw. Bewegungen getriggert, sie stellen
die normale Körperstellung wieder her und erhalten das Gleichgewicht.
Rezeptoren im Gleichgewichtsorgan und den Muskelspindeln sowie in der
Netzhaut liegen am Beginn der betreffenden Reflexbögen.
Stellreflexe (statomotorische, statokinetische Reflexe)
werden durch äußere Störungen bzw. Bewegungen getriggert, sie stellen
die normale Körperstellung wieder her und erhalten das Gleichgewicht.
Rezeptoren im Gleichgewichtsorgan und den Muskelspindeln sowie in der
Netzhaut liegen am Beginn der betreffenden Reflexbögen. Über vestibulookuläre Reflexe - sie steuern die äußere Augenmuskulatur - s. dort
Über vestibulookuläre Reflexe - sie steuern die äußere Augenmuskulatur - s. dort
 Abbildung: Leistungen von Hirnstammsegmenten
Abbildung: Leistungen von Hirnstammsegmenten
 Okulomotorik -
Okulomotorik -  s. dort (N. oculomotorius, trochlearis, abducens - III, IV, VI) (
s. dort (N. oculomotorius, trochlearis, abducens - III, IV, VI) ( Abbildung)
Abbildung) Über den Stapediusreflex
Über den Stapediusreflex  s. dort
s. dort Reflexzentren für die Steuerung von Herz und Kreislauf, z.B. der Barorezeptorreflex
(
Reflexzentren für die Steuerung von Herz und Kreislauf, z.B. der Barorezeptorreflex
( Kreislaufzentrum)
Kreislaufzentrum)  Steuerung von Respiration (
Steuerung von Respiration ( Atemzentrum) und
Atemzentrum) und  Säure-Basen-Haushalt zur Stabilisierung der Atemgaswerte und des pH-Wertes
Säure-Basen-Haushalt zur Stabilisierung der Atemgaswerte und des pH-Wertes Reflexe, die sich auf das Verdauungssystem beziehen
Reflexe, die sich auf das Verdauungssystem beziehen  s. dort
s. dort Der Hirnstamm beteiligt sich auch an der
Der Hirnstamm beteiligt sich auch an der  Schlafsteuerung; reziprok wirkende Neuronen regen
unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye movements,
non-REM-Schlaf) an.
Schlafsteuerung; reziprok wirkende Neuronen regen
unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye movements,
non-REM-Schlaf) an. Lidschlussreflex (Cornealreflex
Lidschlussreflex (Cornealreflex
 , Conjunctivalreflex
, Conjunctivalreflex  ): Dieser Reflex wirkt konsensuell (auf beide Augen) und schließt eine Hebung der Augäpfel ein (Bell-Phänomen
): Dieser Reflex wirkt konsensuell (auf beide Augen) und schließt eine Hebung der Augäpfel ein (Bell-Phänomen , palpebral oculogyric reflex). Berührung der Hornhaut oder dessen unmittelbare Umgebung (Afferenz: N. ophthalmicus, ein Ast des N. trigeminus),
starker Lichtreiz (Afferenz: Sehnerv) oder allgemein Schreckreize (z.B.
lauter Knall) lösen über die formatio reticularis innerhalb von ~0,25 s Kontraktion des
m.orbicularis oculi (Lidschluss - über Äste des N. facialis), weiters Tränensekretion und Zurückweichen des
Kopfes aus.
Dieser auch
Orbicularis-oculi- oder Blinkreflex genannte Vorgang schützt
vor Fremdkörpern, Austrocknung oder Schädigung des Augapfels. In die
Reflexbahn integriert sind (je nach Auslöser und Reflexstärke)
Strukturen wie die oberen Vierhügel, der nucleus ruber, die formatio
reticularis, schließlich der Fazialiskern und evt. weitere motorische
Neuronengruppen.
, palpebral oculogyric reflex). Berührung der Hornhaut oder dessen unmittelbare Umgebung (Afferenz: N. ophthalmicus, ein Ast des N. trigeminus),
starker Lichtreiz (Afferenz: Sehnerv) oder allgemein Schreckreize (z.B.
lauter Knall) lösen über die formatio reticularis innerhalb von ~0,25 s Kontraktion des
m.orbicularis oculi (Lidschluss - über Äste des N. facialis), weiters Tränensekretion und Zurückweichen des
Kopfes aus.
Dieser auch
Orbicularis-oculi- oder Blinkreflex genannte Vorgang schützt
vor Fremdkörpern, Austrocknung oder Schädigung des Augapfels. In die
Reflexbahn integriert sind (je nach Auslöser und Reflexstärke)
Strukturen wie die oberen Vierhügel, der nucleus ruber, die formatio
reticularis, schließlich der Fazialiskern und evt. weitere motorische
Neuronengruppen. Über Lidschlussreflex, Konditionierung und Kleinhirn s. dort
Über Lidschlussreflex, Konditionierung und Kleinhirn s. dort Niesreflex:
Reize in der Nasenschleimhaut führen zu tiefer Einatmung, Verschluss
der
Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur und plötzlichem Öffnen
der Glottis mit explosivem Entweichen der Luft (Niesen). Bei bis ztu
35% der Menschen kann Niesen durch rasche Erhöhung der
Lichtintensität (z.B. an die Sonne treten) ausgelöst werden, man
spricht dann von einem photischen
Niesreflex:
Reize in der Nasenschleimhaut führen zu tiefer Einatmung, Verschluss
der
Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur und plötzlichem Öffnen
der Glottis mit explosivem Entweichen der Luft (Niesen). Bei bis ztu
35% der Menschen kann Niesen durch rasche Erhöhung der
Lichtintensität (z.B. an die Sonne treten) ausgelöst werden, man
spricht dann von einem photischen  Niesreflex (auch Photoptarmose
Niesreflex (auch Photoptarmose  genannt - Ursache unklar, möglicherweise spielt eine Nähe des N. II zum N. V - der u.a. die Nasenschleimhaut innerviert - eine Rolle)
genannt - Ursache unklar, möglicherweise spielt eine Nähe des N. II zum N. V - der u.a. die Nasenschleimhaut innerviert - eine Rolle) Hustreflex:
Durch Schleimhautreize im Schlund-, Kehlkopf- und Luftwegsbereich,
Ablauf ähnlich wie beim Niesreflex, aber ohne vorherige tiefe Einatmung
Hustreflex:
Durch Schleimhautreize im Schlund-, Kehlkopf- und Luftwegsbereich,
Ablauf ähnlich wie beim Niesreflex, aber ohne vorherige tiefe Einatmung Der Hirnstamm enthält ein motorisches Zentrum, das rhythmische Bewegungen der Kaumuskulatur koordiniert ("Kaumustergenerator",
Der Hirnstamm enthält ein motorisches Zentrum, das rhythmische Bewegungen der Kaumuskulatur koordiniert ("Kaumustergenerator",  Abbildung)
und dabei einerseits sensorische Rückmeldungen aus dem Mund-, Nasen-
und Rachenbereich berücksichtigt, andererseits unter der Kontrolle
höherer Zentren - vor allem des Frontal- und Temporalhirns steht.
Abbildung)
und dabei einerseits sensorische Rückmeldungen aus dem Mund-, Nasen-
und Rachenbereich berücksichtigt, andererseits unter der Kontrolle
höherer Zentren - vor allem des Frontal- und Temporalhirns steht. Der Salivations- (Speichelfluss-) Reflex erhöht die basale Speichelsekretion von ~0,3 ml/min (unter 0,1 ml/min: Hyposalivation) durch entsprechende psychische oder sensorische Reize auf ein Mehrfaches dieses Wertes (>0,7 ml/min, meist mehrere ml/min).
Der Salivations- (Speichelfluss-) Reflex erhöht die basale Speichelsekretion von ~0,3 ml/min (unter 0,1 ml/min: Hyposalivation) durch entsprechende psychische oder sensorische Reize auf ein Mehrfaches dieses Wertes (>0,7 ml/min, meist mehrere ml/min). Der Schluckreflex wird durch Reizung von Mechanorezeptoren in der Schleimhaut (Zungengrund, Gaumen, Rachenhinterwand) getriggert. Afferente Fasern laufen im N. glossopharyngeus (IX) und vagus (X) zum
“Schluckzentrum” im Hirnstamm (
Der Schluckreflex wird durch Reizung von Mechanorezeptoren in der Schleimhaut (Zungengrund, Gaumen, Rachenhinterwand) getriggert. Afferente Fasern laufen im N. glossopharyngeus (IX) und vagus (X) zum
“Schluckzentrum” im Hirnstamm ( Abbildung oben).
Abbildung oben). 
 Abbildung: Brechreflex
Abbildung: Brechreflex Antihistaminika wie Promethazin wirken über H1-Rezeptoren sedierend und möglicherweise im Vestibularapparat anticholinerg.
Antihistaminika wie Promethazin wirken über H1-Rezeptoren sedierend und möglicherweise im Vestibularapparat anticholinerg.
 Brechreflex (
Brechreflex ( Abbildung):
Erbrechen (Emesis, Vomitus) ist
ein Schutzmechanismus, der den Organismus vor potenziell giftigen
Substanzen oder intensiven Dehnungsreizen befreien soll. Sein Ablauf
wird von einer Region des Hirnstamms gesteuert, die unter dem Begriff
"Brechzentrum" zusammengefasst wird. Wichtige Transmitter bei Auslösung
und Ablauf des Brechreflexes sind Acetylcholin, Histamin, Serotonin,
Dopamin, Substanz P, möglicherweise auch Enkephaline und
Endocannabinoide.
Abbildung):
Erbrechen (Emesis, Vomitus) ist
ein Schutzmechanismus, der den Organismus vor potenziell giftigen
Substanzen oder intensiven Dehnungsreizen befreien soll. Sein Ablauf
wird von einer Region des Hirnstamms gesteuert, die unter dem Begriff
"Brechzentrum" zusammengefasst wird. Wichtige Transmitter bei Auslösung
und Ablauf des Brechreflexes sind Acetylcholin, Histamin, Serotonin,
Dopamin, Substanz P, möglicherweise auch Enkephaline und
Endocannabinoide. Abbildung). Auf diese Neurone projizieren auch Signale vom Gleichgewichtsorgan (z.B. können starke
Drehbewegungen Übelkeit hervorrufen). Die area postrema unterliegt nicht der Blut-Hirn-Schranke, sondern hat fenestrierte Kapillaren,
was Neuronen das "Eintauchen" in die Blutbahn und die Sondierung derer
Inhalte erlaubt.
Abbildung). Auf diese Neurone projizieren auch Signale vom Gleichgewichtsorgan (z.B. können starke
Drehbewegungen Übelkeit hervorrufen). Die area postrema unterliegt nicht der Blut-Hirn-Schranke, sondern hat fenestrierte Kapillaren,
was Neuronen das "Eintauchen" in die Blutbahn und die Sondierung derer
Inhalte erlaubt. Würgreflex (Pharyngealreflex, gag reflex): Ausgelöst wird er
durch Berührung rückwärtiger Rachenregionen (Zungengrund, weicher Gaumen) und bewirkt deren
Kontraktion, mit dem Ziel, das Eindringen von Fremdkörpern in die
Atemwege zu verhindern (Schutz vor Ersticken). Afferenzen laufen vor allem über den N. vagus (auch etwas über den N. glossopharyngeus), das Reflexzentrum liegt in formatio reticularis und nucleus ambiguus;
letzterer entsendet Motoneurone zur rückwärtigen Rachenmuskulatur. Der
Gaumen wird angehoben, die Rachenmuskulatur schnürt sich zusammen, der
Zugang zu den Luftwegen wird verschlossen, das Irritans möglichst
ausgeworfen.
Würgreflex (Pharyngealreflex, gag reflex): Ausgelöst wird er
durch Berührung rückwärtiger Rachenregionen (Zungengrund, weicher Gaumen) und bewirkt deren
Kontraktion, mit dem Ziel, das Eindringen von Fremdkörpern in die
Atemwege zu verhindern (Schutz vor Ersticken). Afferenzen laufen vor allem über den N. vagus (auch etwas über den N. glossopharyngeus), das Reflexzentrum liegt in formatio reticularis und nucleus ambiguus;
letzterer entsendet Motoneurone zur rückwärtigen Rachenmuskulatur. Der
Gaumen wird angehoben, die Rachenmuskulatur schnürt sich zusammen, der
Zugang zu den Luftwegen wird verschlossen, das Irritans möglichst
ausgeworfen. Störungen im Hirnstammbereich betreffen vitale Steuerungen und können
lebensbedrohliche Folgen haben.
Störungen im Hirnstammbereich betreffen vitale Steuerungen und können
lebensbedrohliche Folgen haben. Abbildung).
Abbildung). 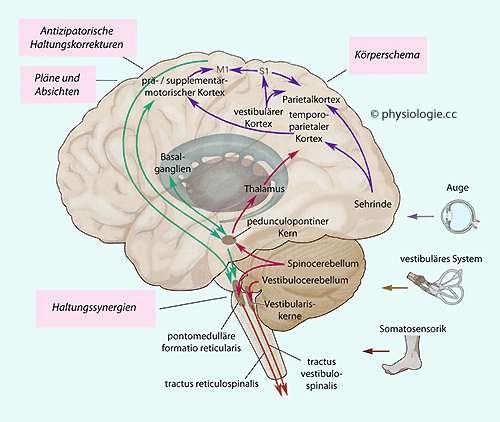
 Abbildung: Kontrolle der Körperhaltung
Abbildung: Kontrolle der Körperhaltung
 Abbildung).
Abbildung).  Der Hirnstamm (medulla oblongata, pons, mesencephalon) ermöglicht die
Erhaltung des Gleichgewichts (posturale Koordination). Zum
ventromedialen System (Körperhaltung, Fortbewegung) gehören die tractus
tecto- (Sehen, Hören), reticulo- und vestibulospinalis. Der fasciculus
longitudinalis medialis verbindet okulomotorische mit
Vestibulariskernen; der nucleus ruber projiziert (tractus rubrospinalis)
auf motorische Vorderhornzellen (Anregung von Flexoren) und (via nucl.
olivaris) Kleinhirn
Der Hirnstamm (medulla oblongata, pons, mesencephalon) ermöglicht die
Erhaltung des Gleichgewichts (posturale Koordination). Zum
ventromedialen System (Körperhaltung, Fortbewegung) gehören die tractus
tecto- (Sehen, Hören), reticulo- und vestibulospinalis. Der fasciculus
longitudinalis medialis verbindet okulomotorische mit
Vestibulariskernen; der nucleus ruber projiziert (tractus rubrospinalis)
auf motorische Vorderhornzellen (Anregung von Flexoren) und (via nucl.
olivaris) Kleinhirn Die formatio reticularis exzitatorisch auf Thalamus und Großhirnrinde
(Aufmerksamkeit: ARS), limbisches System, Thalamus, Hypothalamus und
Rückenmark. Über den tractus reticulospinalis regt sie Extensoren an -
wie die Vestibulariskerne (Kopf- und Körperhaltung) - sowie Motorik mit starker vegetativer
Beteiligung, z.B. Kältezittern Die formatio reticularis exzitatorisch auf Thalamus und Großhirnrinde
(Aufmerksamkeit: ARS), limbisches System, Thalamus, Hypothalamus und
Rückenmark. Über den tractus reticulospinalis regt sie Extensoren an -
wie die Vestibulariskerne (Kopf- und Körperhaltung) - sowie Motorik mit starker vegetativer
Beteiligung, z.B. Kältezittern Halte- (Steh-) und Stell- (statomotorische, statokinetische) Reflexe
werden von verschiedenen Sinnesreizen ausgelöst: Gesehenes, Gehörtes
(tr. tectospinalis), Gleichgewicht (Vestibularapparat), Berührungen
(Haut) und Tiefensensibilität (Muskelspindeln) im Bereich von Hals und
Nacken. Sie richten Kopf, Rumpf und Gliedmaßen entsprechend der
Schwerkraft aus (Justierung von Kopf und des Körper, Aufrechterhaltung
des Gleichgewichts). Haltereflexe stabilisieren den Körper
(Extensoren), Stellreflexe werden durch äußere Störungen bzw.
Bewegungen getriggert
Halte- (Steh-) und Stell- (statomotorische, statokinetische) Reflexe
werden von verschiedenen Sinnesreizen ausgelöst: Gesehenes, Gehörtes
(tr. tectospinalis), Gleichgewicht (Vestibularapparat), Berührungen
(Haut) und Tiefensensibilität (Muskelspindeln) im Bereich von Hals und
Nacken. Sie richten Kopf, Rumpf und Gliedmaßen entsprechend der
Schwerkraft aus (Justierung von Kopf und des Körper, Aufrechterhaltung
des Gleichgewichts). Haltereflexe stabilisieren den Körper
(Extensoren), Stellreflexe werden durch äußere Störungen bzw.
Bewegungen getriggert Der Hirnstamm verwaltet den Lidschluss- (Korneal-, Konjunktival-),
Nies-, Husten-, Salivations- (Speichelfluss-), Schluck-, Brech-, Würg-
(Pharyngeal-) reflex sowie Zentren zur Steuerung von Kreislauf, Atmung
und Säure-Basen-Haushalt
Der Hirnstamm verwaltet den Lidschluss- (Korneal-, Konjunktival-),
Nies-, Husten-, Salivations- (Speichelfluss-), Schluck-, Brech-, Würg-
(Pharyngeal-) reflex sowie Zentren zur Steuerung von Kreislauf, Atmung
und Säure-Basen-Haushalt Im Hirnstamm liegen die Kerne der meisten Hirnnerven Im Hirnstamm liegen die Kerne der meisten Hirnnerven Der Hirnstamm beteiligt sich an der Schlafsteuerung, indem reziprok wirkende
Neuronen unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye
movement, non-REM-Schlaf) anregen Der Hirnstamm beteiligt sich an der Schlafsteuerung, indem reziprok wirkende
Neuronen unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye
movement, non-REM-Schlaf) anregen |
