

Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Frontalhirn
© H. Hinghofer-Szalkay
 Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen
Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen
Brodmann-Areale: Korbinian Brodmann
Broca'sches Areal: Paul Broca
frontal: frons = Stirn
Der
Frontallappen ist Sitz der motorischen Planung und Steuerung,
von
Teilen des Arbeitsgedächtnisses, und der Kontrolle der Persönlichkeit.
Information aus anderen Cortexarealen wird dabei berücksichtigt: Sehen,
Hören, Fühlen, Erinnerung an frühere Erfahrungen. Das Frontalhirn
tauscht sich mit dem limbischen System aus: Während dieses
Emotionen generiert, ermöglicht das Frontalhirn deren Beherrschung.
Das motorische (Broca'sche) Sprachzentrum
(area 44/45) grenzt an prämotorische Areale und die vordere
Zentralwindung (Bereiche für Gesicht, Rachen und Kehlkopf). Es
verwaltet Motorik und
Bedeutungsanalyse im Rahmen der Sprachverarbeitung. Bei ~95% der rechtshändigen, auch der Mehrzahl linkshändiger Personen ist das motorische Sprachzentrum in der linken Großhirnhemisphäre angesiedelt ("sprachdominante" Hemisphäre), manchmal ist das Sprachzentrum auch bilateral angelegt.
Das Präfrontalhirn - der vordere Teil des Frontallappens - berücksichtigt aktuelle Sinnesinformation in Hinblick auf angebrachte Verhaltensmuster (Analyse- und Überwachungssystem): Es organisiert
das Verhalten im Sinne einer rationalen Kontrollinstanz (Beherrschung
emotionaler Impulse aus dem limbischen System). Seine Afferenzen
stammen nicht nur aus dem (mediodorsalen) Thalamus (glutamaterg),
sondern auch aus Hirnstamm (dopaminerg, noradrenerg, serotoninerg) und
Zwischenhirn (cholinerg, GABAerg).
Der orbitale Präfrontalcortex
kann Glücks- und Angstgefühle generieren - mit seinen Verbindungen u.a.
zu Amygdala und Insel steuert er die "emotionale Persönlichkeit".
|
Die
Rinde des Fontallappens kann als "Aktionscortex" gesehen werden, so wie
posteriore Rindengebiete als sensorisch einzustufen sind: Sie steuert
die Motorik. Der größte Anteil der Frontalhirnrinde wird als
Präfrontalcortex bezeichnet, dieser liegt vor dem motorischen Cortex
und gilt als "Sitz der Vernunft" und der Persönlichkeitskontrolle. Das
Präfrontalhirn koordiniert Augenbewegungen (Okulomotorik), Sprechen (Artikulation) und das Ausdrücken von Emotionen (Mimik) - weitgehend über Hirnnerven. Die vor der Zentralfurche liegenden Gebiete (motorische, prämotorische und supplementärmotorische Rinde) steuern die Skelettmuskulatur über absteigende spinale Pfade (Pyramidenbahn).
Das Frontalhirn koordiniert Motorik und Persönlichkeit
 Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde
Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press
Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde
Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press
Linke
Hemisphäre von lateral, rechte von medial gesehen.
Motorische
Rindenareale befinden sich sowohl auf der lateralen als auch der
medialen Oberfläche des Gehirns.
Die primäre motorische Rinde liegt unmittelbar rostral von der
Zentralfurche. Sie kontrolliert Kraft und Richtung geplanter Bewegungen.
Vor ihr liegen prä- und supplementärmotorische Gebiete, weiter vorne
das frontale Augenfeld. Diese Gebiete sind auf Auswahl, Vorbereitung
und Auslösung von Bewegungen spezialisiert.
Der anteriore gyrus cinguli liegt über dem Balken und unter dem sulcus
cinguli. Seine Aufgabe ist die Selektion und Überwachung motorischer
Programme.
Der parietale Cortex verwaltet und interpretiert sensorische Eingänge
und hilft dem motorischen Gehirn bei der situationsgerechten Auswahl
seiner Programme
 Die
Großhirnrinde steht im Mittelpunkt der Planung, Entscheidung und
Initiierung willkürlich beeinflussbarer Kraftentwicklung bzw.
Bewegungen. In die Kontrolle des Ablaufs sind alle Instanzen der
motorischen Steuerung integriert (
Die
Großhirnrinde steht im Mittelpunkt der Planung, Entscheidung und
Initiierung willkürlich beeinflussbarer Kraftentwicklung bzw.
Bewegungen. In die Kontrolle des Ablaufs sind alle Instanzen der
motorischen Steuerung integriert ( Abbildung):
Abbildung):

 Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen
Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen
Nach einer Vorlage bei Silverthorn, Human Physiology, an integrated approach, 4th Int'l ed. 2007, Pearson / Benjamin Cummings
1:
Sensorische Meldungen (somatisch, visuell etc) - z.B. Feststellung der eigenen Körperposition im Raum
2: Planung und Entscheidung - z.B. Abschätzen der Wirksamkeit einer Handlung
3: Koordination und zeitliche Struktur (Kleinhirn)
4: Ausführung: Kortikospinaltrakt → Skelettmuskeln
5: Ausführung: Extrapyramidalmotorische Beeinflussung von Haltung, Körperbalance, Gang
6: Kontinuierliches Feedback (grüne Pfeile) zu Rückenmark, Kleinhirn und Cortex

Der
Frontallappen  (Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der
Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie
dem Bewusstsein zu tun haben:
(Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der
Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie
dem Bewusstsein zu tun haben:
 Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe
Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe
 Es vollbringt höchste Hirnleistungen
wie
Es vollbringt höchste Hirnleistungen
wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach
moralischen / ethischen Kriterien,
Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen
 Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit
Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist
blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden
werden
Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit
Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist
blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden
werden
 Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen
Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen
und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.
Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen
Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen
und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.
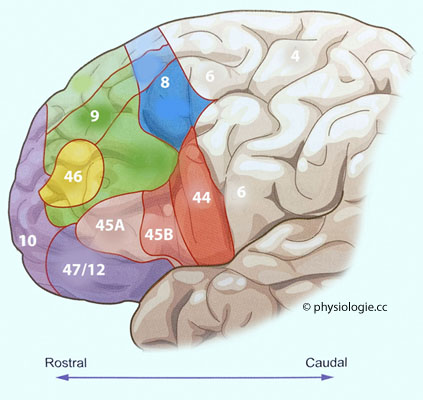
 Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex
Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex
Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press
Die rückwärtige Grenze des Frontallappens (zum Parietallappen) ist der sulcus centralis (caudal von area 4).
Area 8 enthält das frontale Augenfeld, area 9 ist das dorsale präfrontale Areal (Arbeitsgedächtnis, Entscheidungsfindung, soziales Erkennen), area 10 der anteriore Präfrontalcortex, area 12 der Orbitofrontalcortex (sensorische Integration, Entscheidungsfindung), area 44 / 45 der motorische Sprachcortex (Broca-Zentrum), area 47 der orbitale Teil des unteren Frontalcortex

Zuordnung zu Brodmann-Arealen  (
( Abbildung):
Abbildung):
Der
präfrontale Cortex wird uneinheitlich eingeteilt; anatomische,
histologische und physiologische Kriterien überschneiden sich teilweise. Morphologisch unterscheidet man beispielsweise einen lateralen, polaren, orbitalen und medialen Abschnitt:
 Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)
Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)
 Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)
Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)
 Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12
Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12
 Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)
Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)
Der präfrontale Cortex beteiligt sich an der Abstimmung von inneren mit externen Motivationen sowie der Kontrolle von Verhaltensweisen - er ordnet Gefühle und Verhaltensweisen höhergestellten Aspekten unter -, in enger Kooperation mit dem limbischen System (dessen assoziativer Cortex liegt teilweise im Frontalhirn).

 Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung
Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung
Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017
Posterior
gelegene assoziative Rindengebiete beteiligen sich an Wahrnehmung und
Erinnerung, frontale an der Planung motorischer Abläufe. Die
Bewegungsplanung scheint im präfrontalen Cortex zu beginnen und sich
über prä-supplementärmotorische und supplementärmotorische Areale zum
primären Motorcortex "vorzuarbeiten" - ein Vorgang, der mehrere
Sekunden in Anspruch nimmt.
Die Bewegungsplanung des Frontalhirns beruht auf
Eingängen aus assoziativen Arealen in Okzipital- (visuelle
Empfindungen), Parietal- (Raum- und Lageempfindung) und Temporallappen
(Hörempfindung)

Der supplementärmotorische Cortex (SMA: supplementary motor area)
spielt eine entscheidende Rolle für die Durchführung von
Bewegungsabfolgen. Er kümmert sich um die Planung jeweils nachfolgender
(nächster) Komponenten einer Reihe motorischer Elemente (deren
tatsächliche Durchführung dann dem primären motorischen Cortex obliegt).
Der weiter vorne liegende Prä-supplementärmotorische Cortex (pre-SMA) ( Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden
zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor
(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung
verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur
motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im
präfrontalen Cortex - zu reifen.
Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden
zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor
(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung
verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur
motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im
präfrontalen Cortex - zu reifen.
Frontalhirnausfall führt zu Schwankungen zwischen Antriebslosigkeit und Euphorie, Beharren auf Tätigkeitsabläufen (Perseverationen),
Ablenkbarkeit und Reizbarkeit, gestörter Planung motorischer Abläufe,
emotionaler Labilität, Distanzlosigkeit, Impulsivität und sexuellem
Fehlverhalten.
Der rückwärtige Teil des Frontallappens enthält motorische und prämotorische Rindengebiete. Der weiter vorne gelegene präfrontale Cortex übernimmt kognitive Aufgaben und wird in einen dorsolateralen und einen orbitofrontalen Anteil gegliedert.
 Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung
Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung
 Schädigungen des orbitofrontalen
Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),
emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration
Schädigungen des orbitofrontalen
Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),
emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration
Fluss und Aufrechterhaltung des Arbeitsgedächtnisses (Sekunden bis Minuten) werden vom Frontallappen gesteuert - zusammen mit Parietalhirn, gyrus cinguli und Basalganglien. Zur prämotorischen Rinde gehört auch das frontale Augenfeld
in der area 8; es steuert Kerne in Mittel- und Zwischenhirn an,
welche dann die Aktivität der motorischen Augenmuskelkerne (N. III, IV,
VI) koordinieren.
 Über motorische Efferenzen (absteigende Bahnen von Gehirn bis Rückenmark) s. dort
Über motorische Efferenzen (absteigende Bahnen von Gehirn bis Rückenmark) s. dort
Motorisches Sprachzentrum (Broca)
Als motorisches (Broca'sches  ) Sprachzentrum
(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis
des
gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht (
) Sprachzentrum
(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis
des
gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht ( vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.
vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.
Diese Teile spielen neben der
Generierung der Sprachmotorik (z.B. beim Vorlesen, beim spontanen
Sprechen) auch eine wichtige Rolle für die kognitive
Gedächtniskontrolle (die verbalisiert, d.h. in Worte gefasst wird) und semantische (bedeutungsmäßige) Sprachverarbeitung.
Das Broca-Areal grenzt an das prämotorische Areal
und Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf
steuern und beinhaltet die Bewegungsprogramme, die beim Sprechen
benötigt werden.
Störungen dieses Zentrums führen zu motorischer Aphasie  (Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst
aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.
(Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst
aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.
Wie für andere Cortexareale gilt allerdings auch für das Broca-sche
Sprachzentrum, dass seine Leistungen - manchmal, nicht immer - auf benachbarte oder
kontralateral- korrespondierende Rindengebiete umgelernt werden können (z.B. bei Auftreten eines langsam wachsenden Tumors - neuronale Plastizität).
 Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält
die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung
(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die
linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins
verantwortlich.
Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält
die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung
(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die
linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins
verantwortlich.
Die rechte Hemisphäre dient komplexen visuellen
Verarbeitungen (dreidimensionale Vorstellung, Mustererkennung,
beispielsweise eines Gesichts ... Fehlfunktion: Prosopagnosie), Musikverständnis usw. Die
Gesamtleistungen des Gehirns ergeben sich durch Zusammenarbeit der
beiden spezialisierten Hemisphären (vgl. split brain).
Das Präfrontalhirn ist der vordere Teil des Frontallappens; es enthält Afferenzen aus dem mediodorsalen Thalamus. Das Präfrontalhirn
kontrolliert Emotionen und gilt als der "Sitz der Persönlichkeit".
Es verwaltet das Kurzzeitgedächtnis und organisiert ein motorisch und emotional angemessenes Verhalten.
Bei Primaten ist es besonders stark entwickelt; es ermöglicht die
laufende Kurzzeitspeicherung neuer Information und konstituiert so eine
wesentliche Stütze des Arbeitsgedächtnisses.
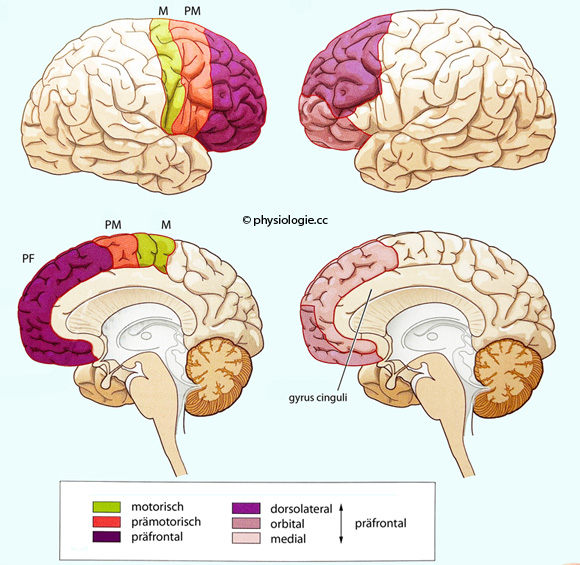
 Abbildung: Frontalhirn
Abbildung: Frontalhirn
Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press
Die drei Hauptabschnitte des Frontalhirns sind der motorische (M), prämotorische (PM) und präfrontale Cortex (PF).
Die Präfrontalregion wird weiter unterteilt in eine dorsolaterale, orbitale (orbitofrontale) und mediale (ventromediale). Dorsolaterale Cortexanteile beschäftigen sich mit Gedächtnis und exekutiven Funktionen, orbitale mit der Verarbeitung von Emotionen, mediale mit Beurteilung, Fehlererkennung und Entscheidungsfindung

Der mediale Präfrontalcortex ist Teil des Default Mode Network, dessen Teile ihre Aktivität beim "Versenken" in das "Innere Ich" synchronisieren ( s. dort).
s. dort).
Zu den Aufgaben des medialen Präfrontalcortex gehört auch die Bewegungsplanung; er übernimmt dabei die Rolle eines central command für die Kreislaufsteuerung während körperlicher Belastung.
Das Präfrontalhirn
 hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten
hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten
 verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische
und somatosensorische Information
verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische
und somatosensorische Information
 integriert
diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich
gerade befindet.
integriert
diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich
gerade befindet.
Man spricht von einem Analyse- und Überwachungssystem (supervisory attentional system). Im
Präfrontalhirn erfolgt u.a. auch die
Bewusstwerdung der komplexen Bedeutung gesprochener Worte.
 Der
(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere
Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im
Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.
Der
(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere
Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im
Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.
Glutamat, Aspartat und GABA sind - wie im gesamten Cortex - die am häufigsten verwendeten Transmitterstoffe.
Weiters erhält der Präfrontalcortex folgende Eingänge:
 dopaminerge aus dem Mittelhirn
dopaminerge aus dem Mittelhirn
 noradrenerge aus dem locus coeruleus
noradrenerge aus dem locus coeruleus
 serotoninerge aus den Raphekernen
serotoninerge aus den Raphekernen
 cholinerge aus dem Zwischenhirn.
cholinerge aus dem Zwischenhirn.
Ausgänge: Das Frontalhirn projiziert intensiv auf andere Cortexregionen, wie über den fasciculus longitudinalis superior auf
das Okzipitalhirn und das Temporalhirn (fasciculus arcuatus, fascuculus
uncinatus). Auf Thalamus, Hirnstamm und Rückenmark projizieren
absteigende Fasern, vor allem über die capsula interna (deren Fasern zwischen Thalamus und nucl. caudatus ziehen).

 Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung
Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung
Nach Arnsten AF, Stress signalling pathways that impair
prefrontal cortex structure and function. Nature Rev Neurosci 2009; 10:
410-22
Links: Im entspannten Zustand kann sich das Frontalhirn ungestört seinen Funktionen widmen. Das
Präfromtalhirn ist mit kortikalen und subkortikalen Nachbarregionen topographisch geordnet verknüpft - Emotionen
regulierende Zonen liegen ventral und medial (grün markiert) und solche, die Gedanken und Handlungen steuern, dorsal und lateral (blau markiert). Die dorsolateralen Zonen sind intensiv mit sensorischen und motorischen Rindengebieten verbunden, die ventromedialen mit subkortikalen Strukturen wie Hypothalamus, nucleus amygdalae und nucleus accumbens. Dorsomediale
präfrontale Rindenzonen schließlich ermöglichen Fehleranalyse und
Realitätsabgleich, sie unterstützen Planung und Entscheidungsfindung.
Insgesamt ermöglicht dieses System intelligentes Denken und Verhalten.
Rechts: Kommen ablenkende, intensive oder akut bedrohliche sensorische Impulse dazu, erzeugen die Mandelkerne
Stressreaktionen mit vegetativen und motorischen Mustern, die vom
Frontalhirn schwer beherrschbar werden können. Durch Aktivierung entsprechender Kerngebiete im Hirnstamm kommt es zu intensiver Ausschüttung von Noradrenalin (NA) und Dopamin (DA),
was regulative Funktionen des Frontalhirns schwächt (Arbeitsgedächtnis,
Aufmerksamkeit) und die Mandelkerne anregt - eine Art circulus vitiosus
baut sich auf: "Kontrolle von unten" (z.B. grelle Sinneseindrücke)
ersetzt zusehends die "Kontrolle von oben" (Prüfung auf Relevanz),
Impulse aus den Mandelkernen engen den Entscheidungsspielraum
motorischer Programme ein

Unter Stresseinwirkung kann
erhöhte Aktivität dieser ("archaischen") Gebiete - insbesondere über
dopaminerge und noradrenerge Afferenzen an präfrontale Cortexneurone -
die Funktionen des Frontalhirns empfindlich stören ( Abbildung). Folge ist - insbesondere nach
chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn
verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes
Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und
Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).
Abbildung). Folge ist - insbesondere nach
chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn
verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes
Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und
Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).
Östrogen
scheint die Stressanfälligkeit zu erhöhen, dies könnte erklären, warum das
Depressionsrisiko bei Frauen höher ist als bei Männern.
Orbitofrontalhirn
 s. auch dort
s. auch dort

 Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex
Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex
Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press
Dieser
Abschnitt des Frontallappens liegt direkt über der Augenhöhle (orbita)
- daher die Bezeichnung. Der mediale Teil wird manchmal auch als
ventromedialer präfrontaler Cortex bezeichnet.
Links Lateralansicht, rechts Ansicht von ventral


 Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).
Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).

 Auch
auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn
für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche
Analyse).
Auch
auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn
für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche
Analyse).

 Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen
Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.
Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen
Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.

 Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit
und unterdrückt störende (zusätzliche,
ablenkende)
Komponenten bei der Verhaltensausführung.
Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit
und unterdrückt störende (zusätzliche,
ablenkende)
Komponenten bei der Verhaltensausführung.

 Es führt Informationen
verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.
Es führt Informationen
verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.

 Das
soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie
Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.
Das
soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie
Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.
Der orbitale
Präfrontalcortex ist in die Erzeugung und Kontrolle von Glücks-, aber auch Angstgefühlen involviert - er bringt Emotionen in das Bewusstsein. Für Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig, ist er mit der vorderen Insel, Hippocampus und parahippocampalem Komplex, dem Temporalpol,
Hypothalamus, dem unteren Parietallappen, dem gyrus cinguli und dem Mandelkern
verbunden und empfängt sowohl exterozeptive (die Umwelt betreffende) als auch
interozeptive (den Körper betreffende) Information.
Das
erklärt die große Bedeutung der orbitofrontalen Region für die
Kontrolle des Gefühlslebens. Sind diese Verbindungen gestört,
resultieren Beeinträchtigungen der Entscheidungsfindung, emotionalen
Balance und Motivation.
Läsionen können tiefgreifende Störungen von Verhalten und Persönlichkeit verursachen.
Betroffene Personen zeigen sozial unangebrachtes und
verantwortungsloses Verhalten, sie haben Schwierigkeiten, die
Konsequenzen ihrer Handlungen abzuschätzen, und sie scheinen nicht aus
betreffenden Fehlern lernen zu können ("verlorener moralischer
Kompass"). Intellektuelle Fähigkeiten sind aber ansonsten nicht
beeinträchtigt.
Einerseits sind kortikale Gebiete auf verschiedene Aspekte
der Motorik spezialisiert, andererseits finden sich erhebliche
funktionelle Überlappungen. Die folgende Tabelle stellt die Leistungen
involvierter Hirngebiete einander gegenüber:
Funktionen von Gehirnarealen, die auf Bewegungskontrolle spezialisiert sind

Nach Banich / Compon, Cogntive Neuroscience, 4th ed. 2018
|
Gehirnregion
|
Rechenleistung
|
Bewegungsplanung
|
Unteres Parietalhirn
|
Abschätzung des Zustandes der Extremitäten
|
Supplementäre motorische Rinde
|
Auswahl und Auslösung der Reihenfolge der Bewegungen
|
Prämotorisches Areal
|
Auswahl der Art von Bewegung (z.B. Greifen)
|
Frontales Augenfeld
|
Willkürliche Kontrolle von Sakkaden
|
Posteriore Teile des vorderen gyrus cinguli
|
Auswahl aus alternativen Abläufen, Auslösung neuer und "Überschreiben" gewohnter Abläufe
|
Präzisierung und Auslösung von Bewegungen
|
Kleinhirn
|
Erstellung von "Vorwärts-Modellen"
|
Basalganglien
|
Umschalten zwischen, und Aufteilung / Modulation von Bewegungen und -mustern
|
Motorischer Cortex
|
Einstellen von Kraft und Richtung, Antrieb der Muskelaktivität
|
Bewegungsüberwachung
|
Vorderer gyrus cinguli
|
Abschätzung der Folgen motorischer Aktionen
|
Parietalcortex
|
Berücksichtigung sensorischer Information für Korrekturen der Motorik
|
Beispielsweise kann das Kleinhirn sehr präzise vorgeplante Bewegungsabläufe exekutieren, eine Korrektur während der Ausführung ist nicht mehr möglich; dafür sind das Parietalhirn und die Basalganglien zuständig. Die Hirngebiete arbeiten zusammen, um eine optimale Steuerung der Motorik zu erzielen.
Dazu kommt, dass zwischen den beteiligten Regionen unterschiedliche Verzögerungszeiten
des Informationsflusses auftreten (abhängig von Signalstrecke und
Leitungsgeschwindigkeit, also Myelinisierungsgrad) und auf diese Weise
ein bestimmtes Muster für die Reihenfolge auftritt, in der Aktionspotentialsalven an beteiligten Hirnregionen auftreten.
Die Funktionen des anterioren
(frontopolaren) Präfrontalcortex ( Abbildung: APFC - area 10) ist
trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht
ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit
sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').
Abbildung: APFC - area 10) ist
trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht
ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit
sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').

 Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen
Nach
Simons JS, Spiers HJ. Prefrontal and medial temporal lobe interactions
in long-term memory. Nature Rev Neurosci 2003; 4: 637-48
Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen
Nach
Simons JS, Spiers HJ. Prefrontal and medial temporal lobe interactions
in long-term memory. Nature Rev Neurosci 2003; 4: 637-48
Der Präfrontalcortex kann in einen vorderen (APFC - area Brodmann 10), dorsolateralen (DLPFC - area 46 und 9), ventrolateralen (VLPFC - area 44, 45, 47) und medialen Abschnitt (MPFC - area 25, 32) eingeteilt werden. Die Brodmann-Areale 11, 12 und 14 werden auch als Orbitofrontalcortex
bezeichnet.
Hippocampus, Mandelkerne, Parahippocampus, ento- und
perirhinaler Cortex sind Teile des medialen Temporallappens, der
intensiv mit dem Präfrontalhirn verbunden ist.
Orbitofrontalhirn
und dorsolaterale Rindenanteile sind reziprok mit dem peri- und
entorhinalen Cortex verbunden. Der Hippocampus projiziert
unidirektional auf den medialen Präfrontalcortex, sensorische
Assoziationen werden aus dem medialen Temporalcortex in die perirhinale
und parahippocampale Region projiziert. So tauscht der Präfrontalcortex
reziprok Information mit sensorischen Assoziationsgebieten in Temporal-
und Parietallappen sowie mit zahlreichen subkortikalen Strukturen aus

Der mediale
Präfrontalcortex ( Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.
cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).
Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die
Motivation und beteiligt
sich an der Einleitung von Handlungen.
Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.
cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).
Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die
Motivation und beteiligt
sich an der Einleitung von Handlungen.
Läsionen äußern sich u.a. in mangelnder
Aufmerksamkeit bis Apathie ('Pseudodepression'), Antriebs- und
Muskelschwäche.
Der dorsolaterale Präfrontalcortex
( Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte
Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.
Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte
Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.
Er verknüpft unterschiedliche Ideen und Wahrnehmungen,
vergleicht die momentane Situation mit Erinnerungen und gilt als die
Stelle, an der sich 'Vergangenheit
und Zukunft treffen'. Er blickt in der Zeit
zurück, um aus dem sensorischen Input Bekanntes herauszufiltern,
und gleichzeitig voraus, um einen motorischen
Handlungsplan zu entwerfen.
Der dorsolaterale Präfrontalcortex ist wesentlich am Arbeitsgedächtnis
beteiligt (z.B. wenn man eine Telefonnummer liest und sich kurzzeitig
merkt).
Er reguliert den Fluss motorischer Information;
die oberen Regionen sind dabei auf
zeitlich-sequentielle, die unteren
auf räumliche Aufgaben spezialisiert.
Diese verschiedenen Aufgaben des 'zentralen Processing'
sind schwerpunktmäßig auf unterschiedliche Regionen des präfrontalen Cortex verteilt.
 Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben
beschäftigt, 60% mit motorischen.
Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben
beschäftigt, 60% mit motorischen.
Ein dorsales
System integriert vor allem Information aus der Netzhautperipherie
und somatosensorische aus Rumpf und unteren Extremitäten zu zeitlich-räumlicher Abfolge
des Verhaltens.
Ein ventrales
System empfängt Meldungen aus der Netzhautmitte
und der unteren Temporalregion und kümmert sich um die Einbettung der Identifikation
von Objekten in das Verhalten.
 Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns
Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017
Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns
Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017
Dieser Teil der
Gehirnrinde liegt an der anterioren Basis des Gehirns und erhält
Eingänge aus dorsomedialen Thalamuskernen, Cortex des Temporalhirns,
ventralem Tegmentum, Riechhirn und Mandelkernen. Es projiziert auf
benachbarte Gebiete des Frontalhirns, Cingulum, Hypothalamus,
Hippocampusformation, sowie zurück zu Temporalcortex und Mandelkernen.
Durch diese Verschaltungen erhält der ventromediale Cortex Information
über das Geschehen in der Umgebung sowie Intentionen, die im restlichen
Frontalhirn entstehen. Seine Outputs beeinflussen Verhalten, emotionale
und neuroendokrine Reaktionen. Dabei spielen die nucll. amygdalae eine zentrale Vermittlerrolle. Auch Gefühle der Angst können so entstehen

Der ventromediale präfrontale Cortex (vmPFC, ventromedial prefrontal cortex:  Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die
u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des
limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"
berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen
die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.
Das berühmte Beispiel eines kalifornischen
Vorarbeiters (Phineas Gage),
der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex
war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,
zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und
soziale Interaktion.
Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die
u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des
limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"
berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen
die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.
Das berühmte Beispiel eines kalifornischen
Vorarbeiters (Phineas Gage),
der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex
war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,
zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und
soziale Interaktion.
Angstgefühle werden beim Menschen sehr häufig durch soziales Lernen, weniger durch persönliche Erfahrung aufgebaut (emotionale Konditionierung). Die Mandelkerne spielen dabei eine zentrale Rolle. Der
ventromediale präfrontale Cortex kann umgekehrt solche emotionalen
Konditionierungen wieder löschen (Extinktion). Insgesamt scheint der ventromediale
präfrontale Cortex eine Brücke aufzubauen zwischen Abläufen
automatisierter emotionaler Abläufe einerseits und solchen komplexen
Verhaltens andererseits.
Personen mit Störungen des ventromedialen Präfrontalcortex können die Bedeutung bestimmter Situationen nur in einem abstrakten Sinn
(für Andere) korrekt erkennen, persönliche Konsequenzen (für sich
selbst) erkennen sie nicht und es fällt ihnen schwer, Triviales von
Wichtigem zu unterscheiden. Sie werden emotional instabil, haben eine
geringe Frustrationstoleranz, werden reizbar, ängstlich, manchmal
aggressiv. Weiters können Defekte des ventromedialen Präfrontalcortex zu Psychosyndromen wie einer posttraumatischen Belastungsstörung führen.
Unter Stressbedingungen tritt der
Einfluss
des Frontalhirnsystems zugunsten limbischer Funktionskreise zurück.
Dopaminerge und noradrenerge Projektionen interferieren dann mit der
Informationsverarbeitung im Präfrontalcortex, dessen Gedanken- und
Gefühlskontrolle unterdrückt wird; der Schwerpunkt der Kontrolle
verlagert sich zu limbischen Hirnregionen.
Schädigungen
im präfrontalen Cortex bedingen einen Symptomenkomplex, der unter der
Bezeichnung Frontalhirnsyndrom zusammengefasst wird. Defekte des
Frontalhirns haben z.T schwere Persönlichkeitsveränderungen zur Folge.
 Zu motorischen Funktionen des Frontallappens s. auch dort
Zu motorischen Funktionen des Frontallappens s. auch dort

  Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von
Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der
Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem
Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)
Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von
Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der
Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem
Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)
 Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische
Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und
Motivation modifizieren Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische
Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und
Motivation modifizieren
 Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und
Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen
assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist
verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,
auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren
Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse
Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und
Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen
assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist
verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,
auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren
Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse
 Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,
Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit
Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und
Zielkonzentration
Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,
Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit
Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und
Zielkonzentration
 Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für
Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die
Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert
Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für
Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die
Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert
 Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken
(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und
Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf
steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.
Störungen führen zu motorischer Aphasie
Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken
(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und
Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf
steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.
Störungen führen zu motorischer Aphasie
|

 Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:
Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie
sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und
Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.
Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:
Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie
sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und
Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.




 Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen
Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen Motorisches Sprachzentrum
Motorisches Sprachzentrum  Präfrontalcortex
Präfrontalcortex
 Orbitofrontalhirn
Orbitofrontalhirn  Integrierte Steuerung
Integrierte Steuerung

 Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde
Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde
 Abbildung):
Abbildung):
 Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen
Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen
 (Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der
Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie
dem Bewusstsein zu tun haben:
(Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der
Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie
dem Bewusstsein zu tun haben: Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe
Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe  Es vollbringt höchste Hirnleistungen
wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach moralischen / ethischen Kriterien, Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen
Es vollbringt höchste Hirnleistungen
wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach moralischen / ethischen Kriterien, Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit
Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist
blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden
werden
Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit
Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist
blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden
werden Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen
Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen
und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.
Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen
Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen
und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.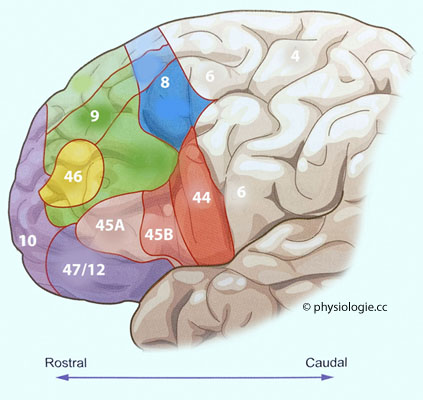
 Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex
Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex
 (
( Abbildung):
Abbildung):  Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)
Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior) Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)
Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis) Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12
Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12 Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)
Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)
 Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung
Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung
 Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden
zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor
(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung
verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur
motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im
präfrontalen Cortex - zu reifen.
Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden
zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor
(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung
verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur
motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im
präfrontalen Cortex - zu reifen. Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung
Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung Schädigungen des orbitofrontalen
Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),
emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration
Schädigungen des orbitofrontalen
Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),
emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration ) Sprachzentrum
(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis
des
gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht (
) Sprachzentrum
(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis
des
gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht ( vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.
vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet. (Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst
aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.
(Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst
aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.
 Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält
die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung
(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die
linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins
verantwortlich.
Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält
die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung
(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die
linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins
verantwortlich. 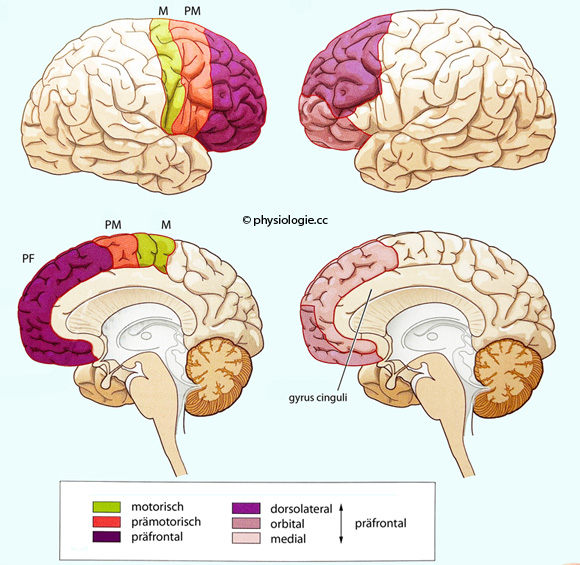
 Abbildung: Frontalhirn
Abbildung: Frontalhirn
 s. dort).
s. dort). hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten
hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische
und somatosensorische Information
verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische
und somatosensorische Information integriert
diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich
gerade befindet.
integriert
diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich
gerade befindet.  Der
(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere
Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im
Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.
Der
(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere
Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im
Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen. dopaminerge aus dem Mittelhirn
dopaminerge aus dem Mittelhirn noradrenerge aus dem locus coeruleus
noradrenerge aus dem locus coeruleus serotoninerge aus den Raphekernen
serotoninerge aus den Raphekernen cholinerge aus dem Zwischenhirn.
cholinerge aus dem Zwischenhirn.
 Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung
Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung
 Abbildung). Folge ist - insbesondere nach
chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn
verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes
Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und
Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).
Abbildung). Folge ist - insbesondere nach
chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn
verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes
Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und
Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD). 
 Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex
Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex

 Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).
Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen). 
 Auch
auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn
für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche
Analyse).
Auch
auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn
für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche
Analyse). 
 Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen
Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.
Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen
Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.
 Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit
und unterdrückt störende (zusätzliche,
ablenkende)
Komponenten bei der Verhaltensausführung.
Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit
und unterdrückt störende (zusätzliche,
ablenkende)
Komponenten bei der Verhaltensausführung. 
 Es führt Informationen
verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.
Es führt Informationen
verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen. 
 Das
soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie
Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.
Das
soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie
Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert. 
 Abbildung: APFC - area 10) ist
trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht
ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit
sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').
Abbildung: APFC - area 10) ist
trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht
ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit
sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching'). 
 Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen
Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen
 Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.
cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).
Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die
Motivation und beteiligt
sich an der Einleitung von Handlungen.
Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.
cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).
Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die
Motivation und beteiligt
sich an der Einleitung von Handlungen.
 Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte
Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.
Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte
Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.  Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben
beschäftigt, 60% mit motorischen.
Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben
beschäftigt, 60% mit motorischen.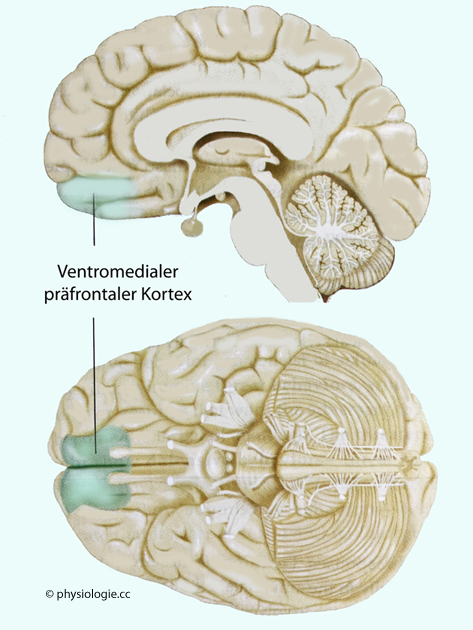
 Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns
Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns
 Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die
u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des
limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"
berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen
die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.
Das berühmte Beispiel eines kalifornischen
Vorarbeiters (Phineas Gage),
der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex
war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,
zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und
soziale Interaktion.
Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die
u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des
limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"
berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen
die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.
Das berühmte Beispiel eines kalifornischen
Vorarbeiters (Phineas Gage),
der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex
war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,
zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und
soziale Interaktion.
 Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von
Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der
Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem
Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)
Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von
Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der
Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem
Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum) Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische
Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und
Motivation modifizieren
Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische
Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und
Motivation modifizieren Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und
Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen
assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist
verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,
auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren
Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse
Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und
Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen
assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist
verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,
auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren
Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,
Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit
Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und
Zielkonzentration
Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,
Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit
Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und
Zielkonzentration Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für
Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die
Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert
Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für
Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die
Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken
(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und
Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf
steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.
Störungen führen zu motorischer Aphasie
Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken
(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und
Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf
steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.
Störungen führen zu motorischer Aphasie