 Adaptation: aptare = anpassen, zurechtmachen
Adaptation: aptare = anpassen, zurechtmachen Evolution: evolvere = enthüllen, abspinnen
Evolution: evolvere = enthüllen, abspinnen| Physiologische
Forschung untersucht Lebensvorgänge und konzentriert sich dabei auf optimale Funktionsweisen. So stellt sie Fragen zur Homöostase (Stabilisierung von Zustandsvariablen); zur Belastbarkeit (Resilienz); oder zur Adaptation (Anpassung an veränderte Umgebungsbedingungen). Subdisziplinen der Physiologie orientieren sich an Funktionen von Zellen, Geweben, Organen und Organismen - Transportvorgänge, Säure-Basen-Haushalt, Wärmeregulation, Orientierung etc. Eine klassische Untergliederung ist die in vegetative (Atmung, Kreislauf, Verdauung..) und animalische Physiologie (Sinnesleistungen, Nervenssytem, Bewegung..). Ein zentraler Begriff der Physiologie ist der des Systems: Ein organisiertes Ganzes, das Funktionen erfüllt, welches die separierten Bestandteile für sich alleine nicht erfüllen können. Physiologische Systeme haben einen Stoffwechsel, sind reproduktions- und anpassungsfähig und verfügen über Attribute, die dem Phänomen Leben insgesamt zukommen. Physiologische Forschung bedient sich wissenschaftlicher Methoden und überprüft laufend die Gültigkeit geltender Vorstellungen (Möglichkeit der Falsifikation), die bei Vorliegen neuer Erkenntnisse gegebenenfalls durch besser fundierte Vorstellungen erweitert oder ersetzt werden. |
 Leben und System
Leben und System  Top-down vs. bottom-up
Top-down vs. bottom-up  Homöostase, Regelung, Adaptation
Homöostase, Regelung, Adaptation
 Reduktionismus
Reduktionismus  Homöostase
Homöostase
 ; die Phänomene, die uns
gesund erhalten können, obwohl wir ständig Krankheitserregern
ausgesetzt sind - und so weiter.
; die Phänomene, die uns
gesund erhalten können, obwohl wir ständig Krankheitserregern
ausgesetzt sind - und so weiter. 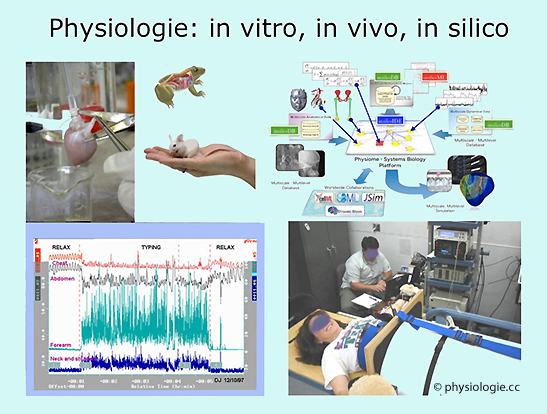
 Abbildung: Experimentelle Zugangsweisen physiologischer Forschung
Abbildung: Experimentelle Zugangsweisen physiologischer Forschung
| Prinzipien in der Physiologie Nach Feher J, Quantitative Human Physiology, 2nd ed. Academic Press / Elsevier 2017 |
 Zellen sind die organisatorischen Bausteine des Lebens Zellen sind die organisatorischen Bausteine des Lebens Homöostase ist ein zentrales Thema der Physiologie Homöostase ist ein zentrales Thema der Physiologie Wir stammen von vergangenen Lebensformen ab, was sich in unserem Genom widerspiegelt Wir stammen von vergangenen Lebensformen ab, was sich in unserem Genom widerspiegelt Physiologische Systeme transformieren Materie und Energie und folgen dabei den Erhaltungsgesetzen Physiologische Systeme transformieren Materie und Energie und folgen dabei den Erhaltungsgesetzen Koordinierte Steuerung und Kontrolle erfordert Signalaustausch auf allen Organisationsebenen Koordinierte Steuerung und Kontrolle erfordert Signalaustausch auf allen Organisationsebenen Kontrollsysteme nutzen Rückkoppelung (negativ und positiv) sowie antizipatorische und Schwellenmechanismen Kontrollsysteme nutzen Rückkoppelung (negativ und positiv) sowie antizipatorische und Schwellenmechanismen |
 Was
passiert in extremen Situationen?
Was
passiert in extremen Situationen?  Wie funktioniert der Körper unter
Bedingungen extremer Drucke, Temperaturen, Beschleunigungswerte, bei eingeschränkter Zufuhr von Wasser, Nahrung, Atemgasen?
Wie funktioniert der Körper unter
Bedingungen extremer Drucke, Temperaturen, Beschleunigungswerte, bei eingeschränkter Zufuhr von Wasser, Nahrung, Atemgasen?  Wie sind "physische" und "psychische" Faktoren und Belastbarkeit verknüpft?
Wie sind "physische" und "psychische" Faktoren und Belastbarkeit verknüpft?  Wie reagiert der Körper auf Stress,
wo liegen die Leistungsgrenzen, wie und wie rasch passt sich der Mensch
an veränderte Bedingungen an?
Wie reagiert der Körper auf Stress,
wo liegen die Leistungsgrenzen, wie und wie rasch passt sich der Mensch
an veränderte Bedingungen an?  Die
Bezeichnung "Physiologie" (φύσις = Natur, λόγος = Lehre) deutet auf
einen ursprünglich viel weiteren Bereich hin als heute. Die Physiologoi, vor allem Thales von Milet, Heraklit und Demokrit
von Abdera, widmeten sich im 5. Jh. v. Chr. dem Studium aller Aspekte
der Natur, einschließlich der Medizin. Ihr Denkansatz war im Grunde ein
rationaler, kausaler und insoferne wissenschaftlicher. Physiologische
Gedanken begannen - soweit heute nachvollziehbar - mit Philosophen des
griechischen Kulturkreises (Hippokrates, Aristoteles, Galen).
Die
Bezeichnung "Physiologie" (φύσις = Natur, λόγος = Lehre) deutet auf
einen ursprünglich viel weiteren Bereich hin als heute. Die Physiologoi, vor allem Thales von Milet, Heraklit und Demokrit
von Abdera, widmeten sich im 5. Jh. v. Chr. dem Studium aller Aspekte
der Natur, einschließlich der Medizin. Ihr Denkansatz war im Grunde ein
rationaler, kausaler und insoferne wissenschaftlicher. Physiologische
Gedanken begannen - soweit heute nachvollziehbar - mit Philosophen des
griechischen Kulturkreises (Hippokrates, Aristoteles, Galen).


 Leben
zeichnet sich durch Kombinationen von Eigenschaften aus wie Energie-
und
Stoffwechsel, Selbstkonstruktion / Selbstorganisation, Reduplikation,
Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Kompetition, Selektion.
Leben
zeichnet sich durch Kombinationen von Eigenschaften aus wie Energie-
und
Stoffwechsel, Selbstkonstruktion / Selbstorganisation, Reduplikation,
Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Kompetition, Selektion.  Dabei gibt es fließende Übergänge zur "unbelebten" Natur: Viren sind
Produkte von
Lebensvorgängen, auf sich alleine gestellt sind sie aber nicht
lebensfähig; überall finden sich Spuren des Lebens - z.B. Kalkstein
(Mikroorganismen, Fossilien), Kohleflöze (Pflanzen), Sauerstoff in
der Atmosphäre (Photosynthese), Technosphäre (humaner Ursprung) -, die
zwar nicht
selbst "leben", aber ohne Leben nicht vorhanden wären.
Dabei gibt es fließende Übergänge zur "unbelebten" Natur: Viren sind
Produkte von
Lebensvorgängen, auf sich alleine gestellt sind sie aber nicht
lebensfähig; überall finden sich Spuren des Lebens - z.B. Kalkstein
(Mikroorganismen, Fossilien), Kohleflöze (Pflanzen), Sauerstoff in
der Atmosphäre (Photosynthese), Technosphäre (humaner Ursprung) -, die
zwar nicht
selbst "leben", aber ohne Leben nicht vorhanden wären. Systeme sind aus interagierenden Elementen aufgebaut (Aristoteles: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile). Steigende Komplexität kombinierter Systeme bringt Eigenschaften, welche über
die ihrer separaten Elemente hinausgehen. Solche Eigenschaften bezeichnet man als emergent (sie "tauchen auf").
Systeme sind aus interagierenden Elementen aufgebaut (Aristoteles: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile). Steigende Komplexität kombinierter Systeme bringt Eigenschaften, welche über
die ihrer separaten Elemente hinausgehen. Solche Eigenschaften bezeichnet man als emergent (sie "tauchen auf").
 Abbildung: Hierarchie-Ebenen lebender Systeme
Abbildung: Hierarchie-Ebenen lebender Systeme
 Abbildung). Mit zunehmender Komplexität sind es immer zahlreichere
Bausteine aus der jeweils niedrigeren Ebene, die in ein höheres
Gesamtsystem einfließen.
Abbildung). Mit zunehmender Komplexität sind es immer zahlreichere
Bausteine aus der jeweils niedrigeren Ebene, die in ein höheres
Gesamtsystem einfließen.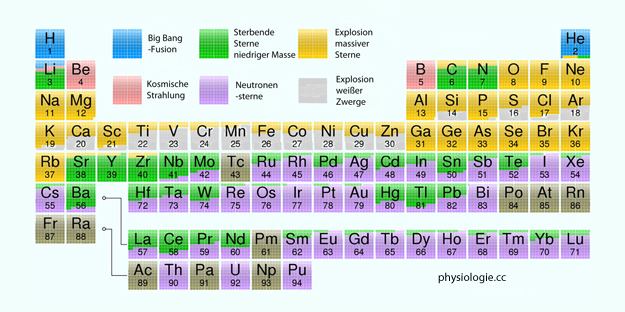

 Abbildung), in weiterer Folge beispielsweise Alkali- und
Erdalkali-Elemente (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) sowie z.B.
Chlorid (Salze!).
Abbildung), in weiterer Folge beispielsweise Alkali- und
Erdalkali-Elemente (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) sowie z.B.
Chlorid (Salze!).  Große Sterne mit ≥1010 kg/m3 Dichte (Sonne ~1,4.103 kg/m3), bei Temperaturen von über einer Milliarde Grad (1.5×109
K), sind "Elementbrüter". So entstandene Materie kann durch Sternenexplosionen (Supernovae) in das
angrenzende Universum verteilt werden.
Große Sterne mit ≥1010 kg/m3 Dichte (Sonne ~1,4.103 kg/m3), bei Temperaturen von über einer Milliarde Grad (1.5×109
K), sind "Elementbrüter". So entstandene Materie kann durch Sternenexplosionen (Supernovae) in das
angrenzende Universum verteilt werden.  Abbildung).
Abbildung).
 Abbildung: Periodensystem und lebenswichtige Elemente
Abbildung: Periodensystem und lebenswichtige Elemente
 Holismus ist die Vorstellung, dass die Teile eines Organismus nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen,
und dass sie nicht isoliert untersucht werden können, ohne dabei
essentielle Information zu verlieren, weil wesentliche Aspekte ihres
Verhaltens alleine auf dieser Interaktion beruhen ("das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile"). Dazu kommt der Umstand, dass
physiologische Systeme zur gleichen Zeit auf verschiedenen Ebenen der
Organisation operieren (molekulare, subzelluläre, zelluläre,
Organebene). Eigenschaften
eines Systems, die nur durch das Zusammenwirken seiner Komponenten
(nicht aber in den vom Ganzen getrennten Untersystemen) auftreten,
nennt man emergent.
Holismus ist die Vorstellung, dass die Teile eines Organismus nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen,
und dass sie nicht isoliert untersucht werden können, ohne dabei
essentielle Information zu verlieren, weil wesentliche Aspekte ihres
Verhaltens alleine auf dieser Interaktion beruhen ("das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile"). Dazu kommt der Umstand, dass
physiologische Systeme zur gleichen Zeit auf verschiedenen Ebenen der
Organisation operieren (molekulare, subzelluläre, zelluläre,
Organebene). Eigenschaften
eines Systems, die nur durch das Zusammenwirken seiner Komponenten
(nicht aber in den vom Ganzen getrennten Untersystemen) auftreten,
nennt man emergent. Reduktionismus
Reduktionismus  ist der Versuch, einen Sachverhalt auf der Basis seiner Komponenten - sozusagen additiv - zu erklären. Der Vorteil dabei: Die isolierte
Untersuchung und Beschreibung von den "Bausteinen" des Lebens her
erlaubt es, diese Subsysteme ohne "störende" Einflüsse durch gleichzeitige Faktoren (im Gesamtsystem) zu verstehen.
ist der Versuch, einen Sachverhalt auf der Basis seiner Komponenten - sozusagen additiv - zu erklären. Der Vorteil dabei: Die isolierte
Untersuchung und Beschreibung von den "Bausteinen" des Lebens her
erlaubt es, diese Subsysteme ohne "störende" Einflüsse durch gleichzeitige Faktoren (im Gesamtsystem) zu verstehen. 
 Abbildung).
So ist es nicht möglich, enzephalographische Entladungsmuster aus der
Physiologie einer einzelnen Nervenzelle abzuleiten, die Struktur eines
EKG aus den Eigenschaften einer separaten Herzmuskelzelle, oder den
Ablauf einer Entzündung aus dem Studium eines weißen Blutkörperchens.
Abbildung).
So ist es nicht möglich, enzephalographische Entladungsmuster aus der
Physiologie einer einzelnen Nervenzelle abzuleiten, die Struktur eines
EKG aus den Eigenschaften einer separaten Herzmuskelzelle, oder den
Ablauf einer Entzündung aus dem Studium eines weißen Blutkörperchens. Funktionsweise von Zellen, Geweben, Organen
Funktionsweise von Zellen, Geweben, Organen Ernährung, Energie- und Substrathaushalt, Temperaturregulation, Wasser-und Elektrolythaushalt, Säure-Basen-Status, Calcium-
und Mineralhaushalt, Knochensystem
Ernährung, Energie- und Substrathaushalt, Temperaturregulation, Wasser-und Elektrolythaushalt, Säure-Basen-Status, Calcium-
und Mineralhaushalt, Knochensystem Wirkungsweise von Hormonen, Sexualität,
Reproduktion, Entwicklung und Wachstum
Wirkungsweise von Hormonen, Sexualität,
Reproduktion, Entwicklung und Wachstum  Funktion der Sinnesorgane, Körperhaltung
und Motorik, Muskulatur, Funktionen des Nervensystems
Funktion der Sinnesorgane, Körperhaltung
und Motorik, Muskulatur, Funktionen des Nervensystems Abwehrvorgänge und Immunsystem
Abwehrvorgänge und Immunsystem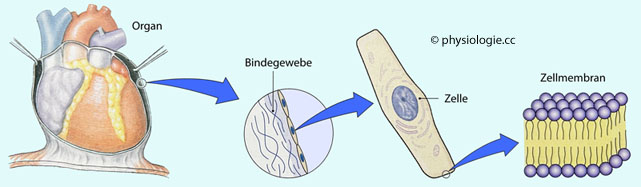
 Abbildung: Physiologische Systeme
Abbildung: Physiologische Systeme
 Evolution
Evolution  -
Geschichte des Lebens und der zugrundeliegenden Mechanismen
-
Geschichte des Lebens und der zugrundeliegenden Mechanismen Ökosysteme - Leben existiert in Ökosystemen, bestehend aus abiotischer Umgebung und Partnerorganismen
Ökosysteme - Leben existiert in Ökosystemen, bestehend aus abiotischer Umgebung und Partnerorganismen Kausale Mechanismen - Wissenschaftliche Deutungen als Ursache und Wirkung
Kausale Mechanismen - Wissenschaftliche Deutungen als Ursache und Wirkung Zelle - Zellen sind die Bausteine des Lebens, wir kennen kein Leben ohne sie
Zelle - Zellen sind die Bausteine des Lebens, wir kennen kein Leben ohne sie Struktur und Funktion -
Leben als Wechselwirkung von Struktur und Funktion auf verschiedenen
Ebenen
Struktur und Funktion -
Leben als Wechselwirkung von Struktur und Funktion auf verschiedenen
Ebenen  Organisationsniveau - Lebewesen funktionieren auf mehreren Organisationsniveaus gleichzeitig
Organisationsniveau - Lebewesen funktionieren auf mehreren Organisationsniveaus gleichzeitig  Informationsflüsse - Steter Informationsfluss innerhalb und zwischen Zellen, Organismen und ihrer Umgebung
Informationsflüsse - Steter Informationsfluss innerhalb und zwischen Zellen, Organismen und ihrer Umgebung  Metabolismus - Lebewesen beziehen Materie und Energie aus
ihrer Umgebung und setzen sie nach ihren Bedürfnissen um
Metabolismus - Lebewesen beziehen Materie und Energie aus
ihrer Umgebung und setzen sie nach ihren Bedürfnissen um Homöostase
Homöostase  - Physiologische Regelungsprozesse ermöglichen und stabilisieren optimale Bedingungen für Lebensvorgänge
- Physiologische Regelungsprozesse ermöglichen und stabilisieren optimale Bedingungen für Lebensvorgänge Homöostase
ist die Kontrolle lebenswichtiger Zustandsvariablen, wie z.B. Blutdruck
oder Sauerstoffaufnahme. Die Zahl solcher Zustandsvariablen (meistens
als "Parameter" bezeichnet) ist groß, und der Organismus verwendet
einen erheblichen Aufwand für ihre Stabilisierung. Homöostase ist ein dynamisches Phänomen: Geringe Abweichungen von einem jeweiligen Optimum
treten ständig auf und veranlassen (im Sinne eines "Systemchecks") die
laufende Feinjustrierung durch Regelsysteme, die dadurch die jeweiligen
Zielgrößen in ihrem optimalen Bereich halten. Zweck der Homöostase ist
die Stabilisierung des "inneren Milieus" (Claude Bernard: milieu intérieur, internal environment)
im Organismus. Zu den involvierten Faktoren gehören z.B. Wasser,
Elektrolyte, Nährstoffe, Atemgase, pH-Wert(e), Temperatur.
Homöostase
ist die Kontrolle lebenswichtiger Zustandsvariablen, wie z.B. Blutdruck
oder Sauerstoffaufnahme. Die Zahl solcher Zustandsvariablen (meistens
als "Parameter" bezeichnet) ist groß, und der Organismus verwendet
einen erheblichen Aufwand für ihre Stabilisierung. Homöostase ist ein dynamisches Phänomen: Geringe Abweichungen von einem jeweiligen Optimum
treten ständig auf und veranlassen (im Sinne eines "Systemchecks") die
laufende Feinjustrierung durch Regelsysteme, die dadurch die jeweiligen
Zielgrößen in ihrem optimalen Bereich halten. Zweck der Homöostase ist
die Stabilisierung des "inneren Milieus" (Claude Bernard: milieu intérieur, internal environment)
im Organismus. Zu den involvierten Faktoren gehören z.B. Wasser,
Elektrolyte, Nährstoffe, Atemgase, pH-Wert(e), Temperatur.
 Abbildung: Homöostase durch negative Rückkopplung
Abbildung: Homöostase durch negative Rückkopplung
 Abbildung). Lebenszustände werden durch Regelungs-, Rückkopplungs- (feedback) und Steuerungsmechanismen stabilisiert (Beispiel: Blutdruckregulation).
Abbildung). Lebenszustände werden durch Regelungs-, Rückkopplungs- (feedback) und Steuerungsmechanismen stabilisiert (Beispiel: Blutdruckregulation).
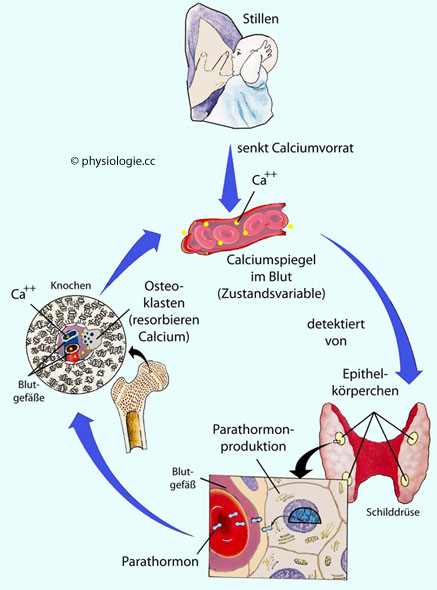
 Abbildung: Beispiel einer endokrinen Rückkopplung
Abbildung: Beispiel einer endokrinen Rückkopplung
 Dabei können sie einander ergänzen (Synergismus), oder in Konkurrenz zueinander stehen (Antagonismus). Beispielsweise senkt Insulin den Blutzuckerspiegel, "antiinsulinäre" Hormone (Glukagon, Adrenalin, Cortisol) erhöhen ihn.
Dabei können sie einander ergänzen (Synergismus), oder in Konkurrenz zueinander stehen (Antagonismus). Beispielsweise senkt Insulin den Blutzuckerspiegel, "antiinsulinäre" Hormone (Glukagon, Adrenalin, Cortisol) erhöhen ihn.  In
vielen Fällen kümmern sich mehr als nur ein System um die
Stabilisierung einer Zustandsgröße (Blutzuckerspiegel, Blutdruck,..),
insbesondere wenn die Regulation von kritischer Bedeutung ist (Redundanz). Fällt einer der beteiligten Regelkreise aus, kann die Regelgröße durch die Aktivität anderer Regelkreise stabilisiert bleiben.
In
vielen Fällen kümmern sich mehr als nur ein System um die
Stabilisierung einer Zustandsgröße (Blutzuckerspiegel, Blutdruck,..),
insbesondere wenn die Regulation von kritischer Bedeutung ist (Redundanz). Fällt einer der beteiligten Regelkreise aus, kann die Regelgröße durch die Aktivität anderer Regelkreise stabilisiert bleiben.  Regelkreise können in hierarchischer Ordnung zueinander stehen, etwa steuern hypothalamische Hormone hypophysäre, und hypophysäre steuern glanduläre Hormone (Beispiel CRH → ACTH → Cortisol).
Regelkreise können in hierarchischer Ordnung zueinander stehen, etwa steuern hypothalamische Hormone hypophysäre, und hypophysäre steuern glanduläre Hormone (Beispiel CRH → ACTH → Cortisol). Schließlich existieren Prioritäten,
z.B. wenn bei körperlicher Belastung die Stabilität des Blutvolumens
vor derjeniger der Körpertemperatur rangiert (Schwitzen kühlt den
Körper, verringert aber das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen).
Schließlich existieren Prioritäten,
z.B. wenn bei körperlicher Belastung die Stabilität des Blutvolumens
vor derjeniger der Körpertemperatur rangiert (Schwitzen kühlt den
Körper, verringert aber das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen). im Organismus selbst (Genschäden, endogene Depression, Alterungsvorgänge, Infekte...) oder
im Organismus selbst (Genschäden, endogene Depression, Alterungsvorgänge, Infekte...) oder in seiner Umwelt (z.B. Fehlernährung, die den Organismus schwächt und für
Störungen empfänglich macht; Veränderung der physikalisch-chemischen
Umweltkomponenten, wie Sauerstoff- oder Substratmangel; Einwirkungen, die zu Verletzungen
führen; Strahlung; etc), oder (sehr oft)
in seiner Umwelt (z.B. Fehlernährung, die den Organismus schwächt und für
Störungen empfänglich macht; Veränderung der physikalisch-chemischen
Umweltkomponenten, wie Sauerstoff- oder Substratmangel; Einwirkungen, die zu Verletzungen
führen; Strahlung; etc), oder (sehr oft) im Zusammenwirken von Faktoren, die im Organismus einerseits, in seiner Umwelt andererseits zu finden sind.
im Zusammenwirken von Faktoren, die im Organismus einerseits, in seiner Umwelt andererseits zu finden sind. Meaning of life?
Die Sinnfrage verlässt den Boden der Naturwissenschaften - sie
orientiert sich an der Bedeutung bzw. dem Zweck des Lebens an sich, sie
ist teleologisch
Meaning of life?
Die Sinnfrage verlässt den Boden der Naturwissenschaften - sie
orientiert sich an der Bedeutung bzw. dem Zweck des Lebens an sich, sie
ist teleologisch  ausgerichtet. Ist die Sinnfrage in diesem Rahmen
überhaupt sinnvoll?
ausgerichtet. Ist die Sinnfrage in diesem Rahmen
überhaupt sinnvoll? Über Genetik und Epigenetik s. dort
Über Genetik und Epigenetik s. dort kann in ganz unterschiedlichen Zeiträumen
erfolgen. Einige Beispiele: Motorische Programme werden reflektorisch innerhalb von
Sekundenbruchteilen adjustiert; hormonelle Reaktionen auf wechselnde
Situationsprofile können innerhalb von Minuten erfolgen; die Regelung
des Blutdrucks wird über Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder Monate
an die jeweiligen Bedingungen angepasst; Organismen können auf
Veränderungen von Umgebungsfaktoren über noch längere Zeiträume reagieren.
kann in ganz unterschiedlichen Zeiträumen
erfolgen. Einige Beispiele: Motorische Programme werden reflektorisch innerhalb von
Sekundenbruchteilen adjustiert; hormonelle Reaktionen auf wechselnde
Situationsprofile können innerhalb von Minuten erfolgen; die Regelung
des Blutdrucks wird über Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder Monate
an die jeweiligen Bedingungen angepasst; Organismen können auf
Veränderungen von Umgebungsfaktoren über noch längere Zeiträume reagieren.
 Physiologie beschäftigt sich mit der Funktionsweise lebendiger Systeme,
medizinische Physiologie in einem klinischen Kontext. Physiologische
Forschung untersucht Mechanismen, die erklären, wie biologische Systeme
funktionieren - mit wissenschaftlichen Methoden. Physiologie
vertieft die Interpretation medizinischer Beobachtungen und Daten und
fließt in Prävention, Diagnostik, Therapie, biomedizinische Technik ein
Physiologie beschäftigt sich mit der Funktionsweise lebendiger Systeme,
medizinische Physiologie in einem klinischen Kontext. Physiologische
Forschung untersucht Mechanismen, die erklären, wie biologische Systeme
funktionieren - mit wissenschaftlichen Methoden. Physiologie
vertieft die Interpretation medizinischer Beobachtungen und Daten und
fließt in Prävention, Diagnostik, Therapie, biomedizinische Technik ein Mit zunehmender Komplexität lebender Systeme erlangen diese emergente
Eigenschaften, welche über Merkmale und Verhalten ihrer (isolierten)
Komponenten (die im System interagieren) hinausgehen und aus der
Analyse der Einzelkomponenten nicht voraussagbar sind. Die
Systemhierarchie reicht von Molekülen bis zu Organismen und deren
Interaktion mit der Umwelt Mit zunehmender Komplexität lebender Systeme erlangen diese emergente
Eigenschaften, welche über Merkmale und Verhalten ihrer (isolierten)
Komponenten (die im System interagieren) hinausgehen und aus der
Analyse der Einzelkomponenten nicht voraussagbar sind. Die
Systemhierarchie reicht von Molekülen bis zu Organismen und deren
Interaktion mit der Umwelt Physiologie wird integrativ (top-down) und reduktionistisch (bottom-up) betrieben. Der integrative Ansatz bemüht
sich um
Berücksichtigung relevanter Bedingungen und Begleitfaktoren des Lebens
mit dem Ziel einer möglichst vollständigen Beschreibung; der
reduktionistische beschränkt sich auf die Analyse von Subsystemen unter
möglichst präzise definierten Bedingungen. Aspekte physiologischer
Untersuchung sind z.B.
Evolution, Wechselwirkung zwischen Struktur und Funktion, Organisationsniveaus, Informationsflüsse, Metabolismus, Homöostase, Anpassung Physiologie wird integrativ (top-down) und reduktionistisch (bottom-up) betrieben. Der integrative Ansatz bemüht
sich um
Berücksichtigung relevanter Bedingungen und Begleitfaktoren des Lebens
mit dem Ziel einer möglichst vollständigen Beschreibung; der
reduktionistische beschränkt sich auf die Analyse von Subsystemen unter
möglichst präzise definierten Bedingungen. Aspekte physiologischer
Untersuchung sind z.B.
Evolution, Wechselwirkung zwischen Struktur und Funktion, Organisationsniveaus, Informationsflüsse, Metabolismus, Homöostase, Anpassung Homöostase ist die Kontrolle von Zustandsvariablen ("Parametern") wie Blutdruck oder Glucosespiegel. Physiologie untersucht Mechanismen, welche Zustandsvariable stabilisieren / beeinflussen / anpassen,
wobei Gebiete optimaler Arbeitsweise als Attraktoren (Chaostheorie) gesehen werden
können. Homöostase hütet Funktionsmuster durch Regelungs-,
Rückkopplungs- und Steuerungsmechanismen (Beispiel
Blutdruckregulation). Allostase betrifft die Fähigkeit, angesichts veränderter Rahmenbedingungen (Stresseinwirkungen) Stabilität adaptiv (durch bestgeeignete Veränderung von Zustandsgrößen) zu erreichen. Beispiele sind veränderte Druck- oder Temperaturbereiche, variierende Nahrungszufuhr, orthostatische Belastung, körperliche Arbeit, mikrobielle Herausforderung Homöostase ist die Kontrolle von Zustandsvariablen ("Parametern") wie Blutdruck oder Glucosespiegel. Physiologie untersucht Mechanismen, welche Zustandsvariable stabilisieren / beeinflussen / anpassen,
wobei Gebiete optimaler Arbeitsweise als Attraktoren (Chaostheorie) gesehen werden
können. Homöostase hütet Funktionsmuster durch Regelungs-,
Rückkopplungs- und Steuerungsmechanismen (Beispiel
Blutdruckregulation). Allostase betrifft die Fähigkeit, angesichts veränderter Rahmenbedingungen (Stresseinwirkungen) Stabilität adaptiv (durch bestgeeignete Veränderung von Zustandsgrößen) zu erreichen. Beispiele sind veränderte Druck- oder Temperaturbereiche, variierende Nahrungszufuhr, orthostatische Belastung, körperliche Arbeit, mikrobielle Herausforderung |



