

Adaptation
(adaptare = sich anpassen)
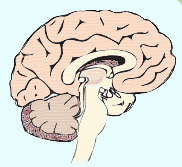
Das Konzept der Forschungsrichtung "adaptive Medizin" geht davon aus,
dass die Anpassung auf Belastungsreize zu
günstigen Effekten im Sinne erhöhter Widerstandskraft (Resilienz) des Organismus
führen. Dabei sind mehrere Dimensionen erkennbar:
Unter bestimmten Bedingungen und in speziellen Teilaspekten gibt es Überschneidungen mit Homöostase, Akkommodation*), Akklimatisierung, Gewöhnung (Habituation), Sensibilisierung.
 Zwei generelle Linien der Begriffsbestimmung sind identifizierbar.
Einerseits kann die Definition so lauten:
Zwei generelle Linien der Begriffsbestimmung sind identifizierbar.
Einerseits kann die Definition so lauten: Adaptation ist die Fähigkeit, umweltbedingte
Störungen zu vermindern bzw. zu korrigieren. Dies trifft auf die
weiter unten erläuterte 'physiologische Adaptation' zu; die Stabilität
gegebener physiologischer Funktionen steht im Vordergrund. Andererseits
wurde formuliert:
Adaptation ist die Fähigkeit, umweltbedingte
Störungen zu vermindern bzw. zu korrigieren. Dies trifft auf die
weiter unten erläuterte 'physiologische Adaptation' zu; die Stabilität
gegebener physiologischer Funktionen steht im Vordergrund. Andererseits
wurde formuliert: Adaptation ist die Fähigkeit, eine verbesserte Nutzung von Umweltfaktoren zu ermöglichen - oder, noch stärker
- in einer Umwelt zu (über)leben, die vorher mit dem (Über-) Leben unvereinbar
war.
Adaptation ist die Fähigkeit, eine verbesserte Nutzung von Umweltfaktoren zu ermöglichen - oder, noch stärker
- in einer Umwelt zu (über)leben, die vorher mit dem (Über-) Leben unvereinbar
war.Die Spielarten von Adaptation können sehr verschieden eingeteilt werden. Folgende Gruppierung erscheint nützlich:
 Phänotypische Adaptation - sie bezieht sich
auf funktionelle Reaktionen des Organismus ohne Änderung der genetischen
Information. Hier kann man wiederum zwei Spielarten erkennen:
Phänotypische Adaptation - sie bezieht sich
auf funktionelle Reaktionen des Organismus ohne Änderung der genetischen
Information. Hier kann man wiederum zwei Spielarten erkennen: 'Modulative' Adaptation - Optimierungsstrategien
führen zu (längerfristig reversiblen) Verschiebungen der Wertebereiche,
zu Veränderungen physiologischer Funktionen (Folgeregelung).
Beispiele sind Enzyminduktion, diverse Stressantworten, Veränderungen
des Blutvolumens, Trainingseffekte an der Muskulatur, oder Lernvorgänge,
z.B. im Nerven- oder Immunsystem.
'Modulative' Adaptation - Optimierungsstrategien
führen zu (längerfristig reversiblen) Verschiebungen der Wertebereiche,
zu Veränderungen physiologischer Funktionen (Folgeregelung).
Beispiele sind Enzyminduktion, diverse Stressantworten, Veränderungen
des Blutvolumens, Trainingseffekte an der Muskulatur, oder Lernvorgänge,
z.B. im Nerven- oder Immunsystem. Genotypische (modifikatorische) Adaptation -
sie bezieht sich auf Änderungen im Erbgut, mit den Zielen einer über
Generationen bleibenden Anpassung an die Umwelt und dadurch resultierende
Selektionsvorteile. Dies ist ein nach wie vor kontroversielles Gebiet (Darwin,
Lamarck, Gould, Lewontin, Mayr seien hier stellvertretend für Viele
erwähnt). Neue Forschungsergebnisse zur Epigenese scheinen lamarckistischen Ideen in gewissem Sinne neuen Auftrieb zu geben.
Genotypische (modifikatorische) Adaptation -
sie bezieht sich auf Änderungen im Erbgut, mit den Zielen einer über
Generationen bleibenden Anpassung an die Umwelt und dadurch resultierende
Selektionsvorteile. Dies ist ein nach wie vor kontroversielles Gebiet (Darwin,
Lamarck, Gould, Lewontin, Mayr seien hier stellvertretend für Viele
erwähnt). Neue Forschungsergebnisse zur Epigenese scheinen lamarckistischen Ideen in gewissem Sinne neuen Auftrieb zu geben. Interaktive Adaptation - sie bezieht sich auf
das Zusammenwirken mehrerer Individuen innerhalb oder über die Grenzen
von Populationen und Arten. Höhere Effizienz oder Symbiose stellen
sich bei 'gleichsinniger', Räuber-Beute-Dynamik bei 'gegensinniger'
Interaktion ein (Volterra & Lotka). Solche Muster lassen sich auch in menschlichen Sozialgefügen
feststellen, ihre wissenschaftliche Erforschung befindet sich in einem
frühen Stadium.
Interaktive Adaptation - sie bezieht sich auf
das Zusammenwirken mehrerer Individuen innerhalb oder über die Grenzen
von Populationen und Arten. Höhere Effizienz oder Symbiose stellen
sich bei 'gleichsinniger', Räuber-Beute-Dynamik bei 'gegensinniger'
Interaktion ein (Volterra & Lotka). Solche Muster lassen sich auch in menschlichen Sozialgefügen
feststellen, ihre wissenschaftliche Erforschung befindet sich in einem
frühen Stadium. Globale Adaptation - sie bezieht sich auf das
Zusammenwirken von Lebewesen im Maßstab von Biomen und der Erde als Ganzem
(Gaia-Hypothese, J. Lovelock). Auch hier steht die Forschung noch
am Anfang; geeignete Modelle, sowohl mathematisch (z.B. das Daisyworld-Modell)
als auch physisch (z.B. Biosphere 2) stellen einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere
Untersuchungen dar.
Globale Adaptation - sie bezieht sich auf das
Zusammenwirken von Lebewesen im Maßstab von Biomen und der Erde als Ganzem
(Gaia-Hypothese, J. Lovelock). Auch hier steht die Forschung noch
am Anfang; geeignete Modelle, sowohl mathematisch (z.B. das Daisyworld-Modell)
als auch physisch (z.B. Biosphere 2) stellen einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere
Untersuchungen dar.Der Begriff 'Adaptation' spielt eine besondere Rolle bei integrativen Ansätzen: Das System wird in Zusammenhang und Interaktion mit anderen gesehen, der Blick auf höhere (komplexere) Systemebenen fokussiert. 'Störgrößen' werden konzeptuell miteinbezogen.
In die andere Richtung, nämlich zur Beschränkung auf Elemente eines Systems und die Erfassung ihrer Funktion in einem isolierten Kontext, gehen reduktionistische Denk- und Forschungsmodelle. Hier trachtet man, komplizierende Einflüsse - u.a. physiologische - möglichst zu vermeiden, um die 'reine' Funktion besser zu durchschauen. In diese Richtung gehen Molekularbiologie und Zellphysiologie. Man verzichtet zugunsten des exakteren Verständnisses auf niedrigeren Organisationsebenen auf die Untersuchung von Interaktionen auf höheren Funktionsebenen.
Von der Methodik her werden die beiden Wege zunächst getrennt beschritten, denn es ist kaum möglich, im Gesamtsystem gleichzeitig die Elemente reduktionistisch 'sauber' zu untersuchen. Ob eine anschließende Synthese der beiden Betrachtungsweisen zu Ergänzung, Synergie und neuer Erkenntnis führen, hängt vom wissenschaftlichen Anspruch der Forscher ab.
Bei der physiologischen Erforschung der Adaptation eines lebenden Systems ergeben sich mehrere Fragen, zum Beispiel:
 An welchen Systemelementen orientieren wir uns?
Im Sinne der 'homöostatischen' Adaptation wären es diejenigen, deren
Funktionsbereich sich trotz Außeneinflüssen nicht verändert, während
'modulative' Adaptation an den Teilen wirkt, die mit einer Neueinstellung
(relativen Optimierung) ihres physiologischen Arbeitsfeldes antworten.
Beides wird in einer gegenenen Situation gleichzeitig zu beobachten sein.
An welchen Systemelementen orientieren wir uns?
Im Sinne der 'homöostatischen' Adaptation wären es diejenigen, deren
Funktionsbereich sich trotz Außeneinflüssen nicht verändert, während
'modulative' Adaptation an den Teilen wirkt, die mit einer Neueinstellung
(relativen Optimierung) ihres physiologischen Arbeitsfeldes antworten.
Beides wird in einer gegenenen Situation gleichzeitig zu beobachten sein. Weiterhin kann das System zwischen mehreren Möglichkeiten
auswählen.
Es geht also nicht nur um Stereotypien, sondern auch um Strategien.
Im Sinne der Modellierung kann hier an einen multidimensionalen Raum gedacht
werden, mit einer Problemlösungs-'Landschaft', die mehrere Optima
aufweist, und von denen nicht von vorneherein gesagt werden kann, welche
in einer bestimmten Situation vorzuziehen wäre.
Weiterhin kann das System zwischen mehreren Möglichkeiten
auswählen.
Es geht also nicht nur um Stereotypien, sondern auch um Strategien.
Im Sinne der Modellierung kann hier an einen multidimensionalen Raum gedacht
werden, mit einer Problemlösungs-'Landschaft', die mehrere Optima
aufweist, und von denen nicht von vorneherein gesagt werden kann, welche
in einer bestimmten Situation vorzuziehen wäre. Drittens liegen keine einfachen kausalen Beziehungen
vor, sondern sind die Systemelemente zu Netzwerken verknüpft, in
denen die Ursachen-Wirkungs-Muster grundsätzlich komplex und nicht genau
voraussagbar sind. Man kann diesen Sachverhalt im Sinne der Chaostheorie
betrachten und die Muster, die sich im lebenden System durchsetzen, als
Attraktoren auffassen. Diese Perspektive hat allerdings in der physiologischen
Systemanalyse (noch) keinen Durchbruch gebracht.
Drittens liegen keine einfachen kausalen Beziehungen
vor, sondern sind die Systemelemente zu Netzwerken verknüpft, in
denen die Ursachen-Wirkungs-Muster grundsätzlich komplex und nicht genau
voraussagbar sind. Man kann diesen Sachverhalt im Sinne der Chaostheorie
betrachten und die Muster, die sich im lebenden System durchsetzen, als
Attraktoren auffassen. Diese Perspektive hat allerdings in der physiologischen
Systemanalyse (noch) keinen Durchbruch gebracht. Als Beispiel für letzteren Fall kann ins Treffen geführt werden, dass
wir über Äonen schrittweise die Fähigkeit verloren haben, essenzielle
Aminosäuren oder Vitamine selbst zu bilden, aber dennoch überlebt
haben, weil wir diese Stoffe aus der Umwelt konsumieren.
Als Beispiel für letzteren Fall kann ins Treffen geführt werden, dass
wir über Äonen schrittweise die Fähigkeit verloren haben, essenzielle
Aminosäuren oder Vitamine selbst zu bilden, aber dennoch überlebt
haben, weil wir diese Stoffe aus der Umwelt konsumieren. Als langfristig können Lernprozesse gelten, die z.B.
nach einer Sensibilisierung zu einer Umstellung im spezifischen Immunsystem
führen und eine lebenslange 'Feiung' gegenüber bestimmten Antigenträgern
zur Folge haben können. Ein Beispiel für kurzfristige Adaptation ist die
Verarbeitung von Stress: Bildung von Hitzeschock-Proteinen, Stresshormonen,
Mobilisierung von Substraten für den Energiestoffwechsel usw.
Als langfristig können Lernprozesse gelten, die z.B.
nach einer Sensibilisierung zu einer Umstellung im spezifischen Immunsystem
führen und eine lebenslange 'Feiung' gegenüber bestimmten Antigenträgern
zur Folge haben können. Ein Beispiel für kurzfristige Adaptation ist die
Verarbeitung von Stress: Bildung von Hitzeschock-Proteinen, Stresshormonen,
Mobilisierung von Substraten für den Energiestoffwechsel usw. der Reizschwelle (ab wann reagiert das System?),
der Reizschwelle (ab wann reagiert das System?), der Kriterien für einen Referenzbereich (was
kann noch als 'gesund' gewertet werden?),
der Kriterien für einen Referenzbereich (was
kann noch als 'gesund' gewertet werden?), der Individualität (inwieweit ist für einen
bestimmten Organismus als typisch, normal, akzeptabel aufzufassen, was
für einen anderen als untypisch, abnorm, inakzeptabel gilt?),
der Individualität (inwieweit ist für einen
bestimmten Organismus als typisch, normal, akzeptabel aufzufassen, was
für einen anderen als untypisch, abnorm, inakzeptabel gilt?), der Charakteristik der Reiz-Wirkungs-Beziehung
(linear, nichtlinear, sigmoid?),
der Charakteristik der Reiz-Wirkungs-Beziehung
(linear, nichtlinear, sigmoid?), der Selbstlimitierung bedeutsam.
der Selbstlimitierung bedeutsam.In der Laborsituation kann eine einzige Umgebungsgröße isoliert und, ceteris paribus, verändert werden. Im realen Leben sind es in der Regel Kombinationen von Einzelfaktoren, die sich ändern und auf deren Muster sich der Organismus einstellen muss. Nicht nur die Antwortstrategie des Körpers auf Reize ist also komplex, es ist auch die Konstellation der Umweltbedingungen, auf deren Gesamtbild hin die Adaptation erfolgt.
Die Umwelt ändert sich ständig, und das erfordert allgemeine Strategien der Adaptation. Nach Isaac Asimov hat der Mensch gerade deswegen überlebt, weil er kein 'Spezialist' ist. Spezialisierung kann zum Nachteil werden, da die Art der zukünftigen Herausforderungen nicht vorhersehbar ist. In diesem Kontext ist das Prinzip der möglichst gleichbleibenden Erbinformation zu verstehen; zu rasche Änderung könnte den Verlust zusätzlicher genetischer Kapazität bedeuten, die zwar im Augenblick überflüssig sein mag, aber in einer geänderten Situation wieder zum Vorteil des Individuums mobilisierbar sein kann.
Wir leben in einem globalen Kontext, in einer Biosphäre, welche die Gesamtheit des irdischen Lebens umfasst. Energetisch wird die Biosphäre einerseits von Sonnenenergie angetrieben (Photosynthese), andererseits von Energie aus geologischen Vorgängen (Subduktion, Vulkanismus). Dieses Lebenserhaltungssystem versorgt uns mit atembarer Luft, trinkbarem Wasser, und essbarer organischer Substanz; und es hält das Weltklima in einem lebensfreundlichen Bereich. Die Anpassung der einzelnen Organismen stellt sich so als Einfügen in einen gemeinsamen Rahmen, eine globale Schicksalsgemeinschaft, dar.
Adaptation kann zu Spezialisierung führen, die in einem bestimmten Kontext vorteilhaft ist, aber die Gefahr in sich birgt, bei geänderten Bedingungsfaktoren nachteilig zu sein: 'Maladaptation'. Die adaptiven Muster sind also nicht an sich, sondern in Abhängigkeit von der Situation, beziehungsweise in einer bestimmten Umgebung sinnvoll. Ein Beispiel ist der Zustand, der sich bei erfolgreicher Anpassung an längere Bettlägrigkeit, den Zustand der Schwerelosigkeit o.ä. im Kreislauf ausbildet (Dekonditionierung): Herabgesetzte orthostatische Regulation, vermindertes Blutvolumen, Abnahme des maximalen Sauerstofftransports. Bei Rückführung an 'normale' Bedingungen (Einwirken der Schwerkraft auf die Längsachse des Körpers, stärkere Muskelbelastung) stellt sich die Adaptation nunmehr als Nachteil heraus - der Organismus passt sich jeweils an die aktuellen Bedingungen an, ohne prädiktive Fähigkeit.
Prädiktiv verhält sich der Organismus allerdings im Sinne von Lernvorgängen: Sich wiederholende Reizmuster können physiologische Mechanismen bedingen, die das Gegenteil der (erwarteten) physiologischen Reizantworten bewirken. So führt die wiederholte Gabe zentralnervös wirkender Pharmaka zu spiegelbildlichen Reaktionsmustern, die bereits vor Auswirkung des 'eigentlichen' Effekts nachweisbar werden (antizipatorische Antwort). Wird der primäre Stimulus nur vorgetäuscht (Konditionierung), kommt es zu einer - eventuell lebensbedrohlichen - Reaktion, die gewissermassen symmetrisch zum erwarteten Effekt verhält.
Adaptation kann in verschiedene Richtungen erfolgen: Die Rückentwicklung zum ursprünglichen Zustand wird auch als Deadaptation bezeichnet. Auch hier stellt sich die Frage, was als 'normal' anzusehen ist. Dies wird an einem Beispiel besonders klar, das von Muralt gegeben hat: Wenn die Physiologie der Geburt in den Anden geschrieben würde, in einer Umgebung, die wir als hypoxisch bezeichnen: Würde das Baby dann in eine 'normoxische' Umgebung geboren - in utero liegen reduzierte Sauerstoff-Partialdruckwerte vor -, während die Bedingungen auf Meereshöhe als 'hyperoxisch' anzusehen sind? Adaptation ist nicht absolut, sondern immer relativ zum jeweiligen Bedingungsfeld zu sehen.
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung längerdauernder Einwirkung von Stressoren treten stereotype physiologische Anpassungsreaktionen auf (Hans Selye: Adaptationssyndrom).
Als adaptiv bezeichnet man denjenigen Teil der Immunantworten, welcher spezifisch auf mikrobiologische Herausforderungen reagiert.
 © Helmut
Hinghofer-Szalkay
© Helmut
Hinghofer-Szalkay