




| Sinnesreize werden von Rezeptoren in elektrische Signale umgesetzt (Transduktion), was sekundäre Vorgänge hervorruft (Transformation). Der Reiz wird codiert: Bei ausreichender Reizstärke am Sinnesorgan
verändern afferente Nervenfasern ihre Erregungsgröße
(Aktionspotentialfrequenz, Zahl involvierter Fasern), und die
Sinnesinformation wird im Zentralnervensystem abgebildet (Projektion). Sinnesrezeptoren können peripher im Gewebe verteilt (z.B. Schmerzrezeptoren) oder in Sinnesorganen organisiert sein (z.B. Photorezeptoren in der Netzhaut). Die afferente Erregung kann anhaltend proportional zur Reizstärke sein oder bei konstanter Reizstärke mit der Zeit abnehmen (Differentialempfindlichkeit). Der wahrnehmbare Unterschied der Reizstärke ist relativ: Das Weber'sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt (die Unterscheidungempfindlichkeit abnimmt). Das vergrößert den Bereich des Empfindlichkeitsspektrums. Sinnesmodalitäten sind z.B. Sehen und Hören, Sinnesqualitäten z.B. gelb und grün. Welchem "Sinn" man afferente Information zuordnet, hängt davon ab, in welche Hirnregion projiziert wird - einerlei, welcher Art der Reiz ist. Das Gebiet in der Peripherie (z.B. der Netzhaut), das die Aktivität einer afferenten Nervenzelle beeinflusst, nennt man deren rezeptives Feld. Reize können "für das Sinnesorgan geschaffen" sein (Licht für das Auge, Schall für das Ohr) - dann nennt man sie adäquat, sie wirken schon bei geringer Reizintensität überschwellig auf das Sinnesorgan. Auch inadäquate Reize können wahrgenommen werden, wenn sie stark genug sind (z.B. Druck auf das Auge). Ob ein Reiz eine sinnesphysiologische Auswirkung hat, hängt von seiner Intensität ab: Löst er eine Erregungsänderung aus, ist er überschwellig; schafft er das nicht, bleibt er unterschwellig. |
 Transformation, Codierung, Proportional- vs. Differentialempfindlichkeit
Transformation, Codierung, Proportional- vs. Differentialempfindlichkeit  Rezeptive Felder, laterale Hemmung
Rezeptive Felder, laterale Hemmung
 Modalität
Modalität  Rezeptorpotential, Generatorpotential, Transformation
Rezeptorpotential, Generatorpotential, Transformation  Akkommodation (Nerv)
Akkommodation (Nerv)  Rezeptives Feld
Rezeptives Feld

 Abbildung: Sensorische Afferenzen zum Gehirn
Abbildung: Sensorische Afferenzen zum Gehirn
 Empfindung: bewusster Sinneseindruck, Kombination von Information aus mehreren Sinnesorganen
Empfindung: bewusster Sinneseindruck, Kombination von Information aus mehreren Sinnesorganen Wahrnehmung: Vergleich der Empfindung mit Erfahrungen, Integration des Gesamtmusters äußerer und innerer Zustände.
Wahrnehmung: Vergleich der Empfindung mit Erfahrungen, Integration des Gesamtmusters äußerer und innerer Zustände. Klassifikation sensorischer Rezeptoren Modifiziert nach Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 |
||||
| System |
Modalität |
Reiz |
Klasse |
wo? |
| Visuell |
Sehen |
Photonen |
Photo- rezeptor (Zapfen, Stäbchen) |
Netzhaut |
| Auditiv |
Hören |
Schall- wellen |
Mechano- rezeptor (Haarzellen) |
Cochlea (Innenohr) |
| Vestibulär |
Kopf- bewegung |
Schwerkraft Beschleunigung Kopfbewegung |
Mechano- rezeptor (Haarzellen) |
Bogengänge (Innenohr) |
| Somato- sensorisch |
Hinterhornzellen mit Rezeptoren in: |
|||
| Berührung |
Verformung / Bewegung |
Mechano- rezeptor |
Haut |
|
| Proprio- zeption |
Muskellänge Muskelkraft Gelenkswinkel |
Mechano- rezeptor |
Muskelspindeln Sehnenspindeln Gelenkskapseln |
|
| Schmerz |
schädigende Einwirkung mechanisch / thermisch / chemisch |
Thermo-, Mechano-, Chemo- rezeptor |
alle Gewebe außer ZNS |
|
| Jucken |
Histamin Pruritogene |
Chemo- rezeptor |
Haut |
|
| viszeral |
Einwirkung mechanisch / thermisch / chemisch | Thermo-, Mechano-, Chemo- rezeptor |
Kardiovaskuläres, gastrointestinales System, Harnblase, Lunge |
|
| Gustatorisch |
Geschmack |
Substanzen |
Chemo- rezeptor |
Geschmacks- knospen, intraorale Thermorezeptoren, Chemorezeptoren |
| Olfaktorisch |
Geruch |
Substanzen |
Chemo- rezeptor |
Olfaktorische sensorische Neurone |
 ) nennt man die Umwandlung eines Sinnesreizes in eine Änderung des
Membranpotentials einer Sinneszelle (Bezeichnungen: Sensorpotential,
Rezeptorpotential, Generatorpotential). Dies erfolgt mittels spezialisierter (mechano-,
chemo-, photosensibler) Membranproteine.
) nennt man die Umwandlung eines Sinnesreizes in eine Änderung des
Membranpotentials einer Sinneszelle (Bezeichnungen: Sensorpotential,
Rezeptorpotential, Generatorpotential). Dies erfolgt mittels spezialisierter (mechano-,
chemo-, photosensibler) Membranproteine.| Ändert sich das Rezeptorpotential, ändert sich auch die Aktionspotentialfrequenz an sensorischen Nervenfasern |
 ) sein, d.h. das Sinnesorgan reagiert auf diese besonders empfindlich.
) sein, d.h. das Sinnesorgan reagiert auf diese besonders empfindlich. | Adäquat sind Reize, auf die Rezeptorzellen besonders empfindlich reagieren (z.B. Netzhaut und Licht), inadäquat solche, auf die das Sinnesorgan nicht spezialisiert ist (z.B. Lichterscheinung bei Druck auf den Augapfel) |

 Abbildung: Sensorische Rezeptoren
Abbildung: Sensorische Rezeptoren
 Direkt über primäre Sinneszellen - diese sind zugleich Sensorzellen und Neuronen. Beispiele: Freie Nervenendigungen (für Geruch, Schmerz-, Temperatursinn -
Direkt über primäre Sinneszellen - diese sind zugleich Sensorzellen und Neuronen. Beispiele: Freie Nervenendigungen (für Geruch, Schmerz-, Temperatursinn -  Abbildung links) oder Nerven mit
Zusatzelementen (somatische und viszerale Mechanorezeptoren -
Abbildung links) oder Nerven mit
Zusatzelementen (somatische und viszerale Mechanorezeptoren -  Abbildung Mitte).
Abbildung Mitte).  Indirekt über sekundäre Sinneszellen. Diese reagieren auf Reize mit einer
Änderung ihrer Transmitterfreisetzung, was an postsynaptischen Nervenzellen eine entsprechende Änderung ihrer
Erregungsgröße (Aktionspotentialgenerierung) auslöst (
Indirekt über sekundäre Sinneszellen. Diese reagieren auf Reize mit einer
Änderung ihrer Transmitterfreisetzung, was an postsynaptischen Nervenzellen eine entsprechende Änderung ihrer
Erregungsgröße (Aktionspotentialgenerierung) auslöst ( Abbildung rechts). Hierher gehören Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn.
Abbildung rechts). Hierher gehören Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn. Als Absolutschwelle bezeichnet man eine Reizstärke, die gerade ausreicht, um eine Empfindung
auszulösen. Die Unterschiedsschwelle (just noticeable difference) ist der Intensitätsunterschied zweier Reize, der gerade noch als Änderung der Reizstärke
empfunden wird. Die Unterschiedsschwelle ist bei den meisten
Sinnesorganen (außer Temperatur- und Schmerzsinn) nicht eine konstante
Reizstärkenzunahme, sondern ein bestimmter Bruchteil des Betrags des
Bezugsreizes; dieser Quotient ist unabhängig von der absoluten
Reizstärke.
Als Absolutschwelle bezeichnet man eine Reizstärke, die gerade ausreicht, um eine Empfindung
auszulösen. Die Unterschiedsschwelle (just noticeable difference) ist der Intensitätsunterschied zweier Reize, der gerade noch als Änderung der Reizstärke
empfunden wird. Die Unterschiedsschwelle ist bei den meisten
Sinnesorganen (außer Temperatur- und Schmerzsinn) nicht eine konstante
Reizstärkenzunahme, sondern ein bestimmter Bruchteil des Betrags des
Bezugsreizes; dieser Quotient ist unabhängig von der absoluten
Reizstärke.  Das Weber-sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt:
Das Weber-sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt:| [k] = ΔR / R |
 das Fechner'sche bzw. Weber-Fechner'sche
Gesetz
das Fechner'sche bzw. Weber-Fechner'sche
Gesetz  (Logarithmierung) und
(Logarithmierung) und  die Stevens'sche Potenzfunktion
die Stevens'sche Potenzfunktion
 (Reaktionsstärke als Funktion der Reizstärke, konstanter Logarithmus).
(Reaktionsstärke als Funktion der Reizstärke, konstanter Logarithmus). Intensität,
Intensität,  Ort des Auftretens (Lokalisation,
Ausdehnung, Richtung),
Ort des Auftretens (Lokalisation,
Ausdehnung, Richtung),  Zeitverlauf,
Zeitverlauf, Qualität bzw. Submodalität (z.B. sauer
- bitter).
Qualität bzw. Submodalität (z.B. sauer
- bitter).  Als Modalität bezeichnet man einen
sinnesphysiologischen "Qualitätskreis", der (subjektiv) nicht direkt mit einem anderen
vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Als Submodalität (Sinnesqualität) bezeichnet man einen Erlebniskreis innerhalb der Modalität (z.B. salzig, süß).
Als Modalität bezeichnet man einen
sinnesphysiologischen "Qualitätskreis", der (subjektiv) nicht direkt mit einem anderen
vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Als Submodalität (Sinnesqualität) bezeichnet man einen Erlebniskreis innerhalb der Modalität (z.B. salzig, süß). (Kopplung physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung) werden
Modalitäten "vermischt" wahrgenommen, z.B. lösen Geräusche auch das
Sehen von Farben aus usw.
(Kopplung physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung) werden
Modalitäten "vermischt" wahrgenommen, z.B. lösen Geräusche auch das
Sehen von Farben aus usw. Reizung einer Sensorstruktur (z.B.
mechanosensitive Zelle) führt zu Veränderung ihres Membranpotentials.
Diese reizproportionale Potentialänderung nennt man Rezeptorpotential oder Generatorpotential. Die
"Übersetzung" dieses Potentials in
entsprechende Erregungsgrößen (Aktionspotentiale bzw. Änderung von
Entladungsfrequenzen, veränderte Freisetzung von Transmitterstoff, z.B.
Glutamat, etc) bezeichnet man als Transformation.
Reizung einer Sensorstruktur (z.B.
mechanosensitive Zelle) führt zu Veränderung ihres Membranpotentials.
Diese reizproportionale Potentialänderung nennt man Rezeptorpotential oder Generatorpotential. Die
"Übersetzung" dieses Potentials in
entsprechende Erregungsgrößen (Aktionspotentiale bzw. Änderung von
Entladungsfrequenzen, veränderte Freisetzung von Transmitterstoff, z.B.
Glutamat, etc) bezeichnet man als Transformation.

 Abbildung: Codierung von Reizstärke und Reizdauer
Abbildung: Codierung von Reizstärke und Reizdauer
 Abbildung),
die sich dann über die
ganze Zelle durch saltatorische Erregungsleitung fortpflanzt. Am
zentralen Ende des Neurons (am Axon-Terminal) wird darauf hin der
entsprechende Neurotransmitter (z.B. Glutamat) ausgeschüttet, was zur
Erregung nachgeschalteter Neurone führt.
Abbildung),
die sich dann über die
ganze Zelle durch saltatorische Erregungsleitung fortpflanzt. Am
zentralen Ende des Neurons (am Axon-Terminal) wird darauf hin der
entsprechende Neurotransmitter (z.B. Glutamat) ausgeschüttet, was zur
Erregung nachgeschalteter Neurone führt. 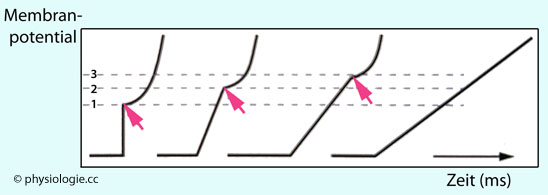
 Abbildung: Akkommodation einer Nervenfaser
Abbildung: Akkommodation einer Nervenfaser
 Abbildung).
Abbildung). Als Akkommodation von
Nervenfasern bezeichnet man die Tatsache, dass die Schwelle zur
Auslösung eines Aktionspotentials von der Geschwindigkeit der
Depolarisierung abhängt, mit der die Schwelle überschritten werden soll
(der Nerv hat sich bei langsamer Depolarisierung an die Depolarisierung
"gewöhnt"). Dieser Effekt ist damit erklärbar, dass die Natriumkanäle
bei einer Reduktion des Membranpotentials nur für kurze Zeit, die
Kaliumkanäle hingegen mit Verzögerung länger geöffnet bleiben; die Zeit
ist sozusagen auf der Seite der Stabilität des Membranpotentials (und
nicht auf der Seite der Generierung von Aktionspotentialen).
Als Akkommodation von
Nervenfasern bezeichnet man die Tatsache, dass die Schwelle zur
Auslösung eines Aktionspotentials von der Geschwindigkeit der
Depolarisierung abhängt, mit der die Schwelle überschritten werden soll
(der Nerv hat sich bei langsamer Depolarisierung an die Depolarisierung
"gewöhnt"). Dieser Effekt ist damit erklärbar, dass die Natriumkanäle
bei einer Reduktion des Membranpotentials nur für kurze Zeit, die
Kaliumkanäle hingegen mit Verzögerung länger geöffnet bleiben; die Zeit
ist sozusagen auf der Seite der Stabilität des Membranpotentials (und
nicht auf der Seite der Generierung von Aktionspotentialen). 
 Abbildung: "Tonische" und "phasische" Rezeptoren
Abbildung: "Tonische" und "phasische" Rezeptoren| Während eines steten Reizes kann die Aktionspotentialfrequenz abnehmen (Differentialverhalten, Adaptation) |

 Abbildung: Rezeptoren in der Haut (schematisch)
Abbildung: Rezeptoren in der Haut (schematisch) Pacini-Körperchen
zeigen ausgeprägte Differentialempfindlichkeit (rasche Adaptation),
Pacini-Körperchen
zeigen ausgeprägte Differentialempfindlichkeit (rasche Adaptation),  Meissner-Tastkörperchen sind Druckrezeptoren der Leistenhaut (Finger, Handinnenseite, Fußsohle - Berührungssinn),
Meissner-Tastkörperchen sind Druckrezeptoren der Leistenhaut (Finger, Handinnenseite, Fußsohle - Berührungssinn),  Merkel-Zellen eher Proportionalempfindlichkeit
(geringe Adaptation; Berührungssinn),
Merkel-Zellen eher Proportionalempfindlichkeit
(geringe Adaptation; Berührungssinn),  Ruffini-Körperchen adaptieren ebenfalls langsam und reagieren auf horizontal einwirkende Dehnungskräfte.
Ruffini-Körperchen adaptieren ebenfalls langsam und reagieren auf horizontal einwirkende Dehnungskräfte.
 Abbildung) ausgeprägt differentialempfindlch: Bei konstantem Reiz nimmt ihre Entladungsfrequenz rasch ab. Umgekehrt reagieren Ruffini-Körperchen oder Merkel-sche Tastscheiben
auch längere Zeit recht gleichbleibend auf die Stärke des mechanischen
Reizes - sie sind stark proportionalempfindlich.
Abbildung) ausgeprägt differentialempfindlch: Bei konstantem Reiz nimmt ihre Entladungsfrequenz rasch ab. Umgekehrt reagieren Ruffini-Körperchen oder Merkel-sche Tastscheiben
auch längere Zeit recht gleichbleibend auf die Stärke des mechanischen
Reizes - sie sind stark proportionalempfindlich. Als rezeptives Feld bezeichnet
man ein
Gebiet in einem (peripheren) sensorischen Areal (z.B. in Haut,
Netzhaut), von dem aus Aktionspotentiale zu einer (zentralen)
Nervenzelle konvergieren. Je kleiner rezeptive Felder sind, desto besser (höher) ist das Auflösungsvermögen in dem betreffenden sensorischen Gebiet (z.B. s. dort). Auf
der Ebene der Nervenzellen können durch kollaterale Verschaltungen
Informationen aus dem sensiblen Feld mit solchen aus benachbarten
Feldern abgeglichen werden. Dabei ergeben sich Veränderungen des
Erregungsmusters, z.B. in Form der lateralen Hemmung,
die der
Kontrastbildung dient und damit verhindert, dass bei der Überschneidung
der Information aus mehreren rezeptiven Feldern ein unscharfes,
statistisch gemitteltes Informations-Mischmasch resultiert.
Als rezeptives Feld bezeichnet
man ein
Gebiet in einem (peripheren) sensorischen Areal (z.B. in Haut,
Netzhaut), von dem aus Aktionspotentiale zu einer (zentralen)
Nervenzelle konvergieren. Je kleiner rezeptive Felder sind, desto besser (höher) ist das Auflösungsvermögen in dem betreffenden sensorischen Gebiet (z.B. s. dort). Auf
der Ebene der Nervenzellen können durch kollaterale Verschaltungen
Informationen aus dem sensiblen Feld mit solchen aus benachbarten
Feldern abgeglichen werden. Dabei ergeben sich Veränderungen des
Erregungsmusters, z.B. in Form der lateralen Hemmung,
die der
Kontrastbildung dient und damit verhindert, dass bei der Überschneidung
der Information aus mehreren rezeptiven Feldern ein unscharfes,
statistisch gemitteltes Informations-Mischmasch resultiert. 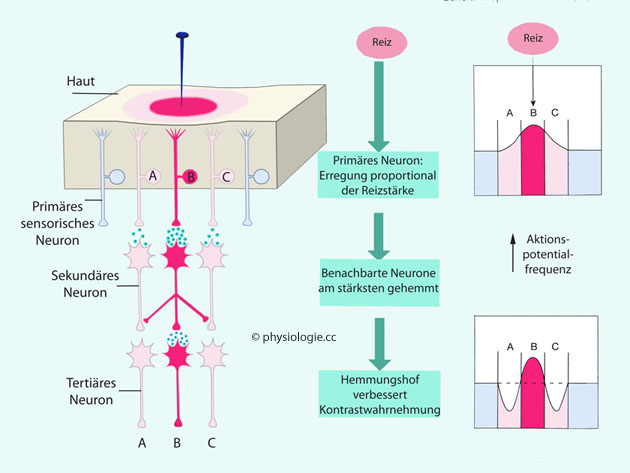
 Abbildung: Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung
Abbildung: Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung
 Abbildung) von einem "Hemmungshof" unringt, hier ist die Entstehung von Aktionspotentialen behindert. Dies dient dem Aufbau bzw. der Verstärkung von Kontrasten.
Abbildung) von einem "Hemmungshof" unringt, hier ist die Entstehung von Aktionspotentialen behindert. Dies dient dem Aufbau bzw. der Verstärkung von Kontrasten. Abbildung):
Abbildung): 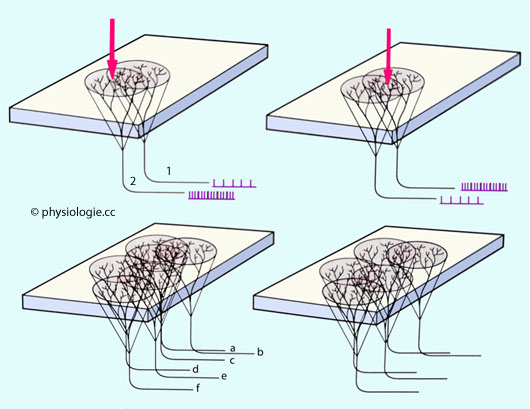
 Abbildung: Vorteile der Überschneidung rezeptiver Felder
Abbildung: Vorteile der Überschneidung rezeptiver Felder vgl. dort
vgl. dort
 Erstens nimmt die Präzision der Ortung
eines Reizpunktes am Sinnesrasen zu: Denn nun erhält das Gehirn über
mehr als nur eine Nervenfaser Information über den exakten Reizpunkt.
Die Veränderung der Entladungsmuster aus den betreffenden Feldern
korrespondiert mit der Veränderung der Reizstelle, und das Gehirn
bezieht redundante Information, was die Genauigkeit der Identifikation
der Reizstelle erhöht.
Erstens nimmt die Präzision der Ortung
eines Reizpunktes am Sinnesrasen zu: Denn nun erhält das Gehirn über
mehr als nur eine Nervenfaser Information über den exakten Reizpunkt.
Die Veränderung der Entladungsmuster aus den betreffenden Feldern
korrespondiert mit der Veränderung der Reizstelle, und das Gehirn
bezieht redundante Information, was die Genauigkeit der Identifikation
der Reizstelle erhöht.  Zweitens erlaubt diese Redundanz der zentralen Repräsentation des
Sinnesrasens eine - zumindest teilweise - Kompensation des Ausfalls von Afferenzen.
Kommt es z.B. zu einer begrenzten Ischämie in einem sensiblen Nerv,
fallen zwar einige afferente Nervenfasern aus und die Qualität der Informationsübertragung leidet, die betroffene Stelle
(z.B. Haut) wird aber noch nicht gefühllos, soferne der Defekt durch
funktionierende Überlappungszonen kompensiert werden kann.
Zweitens erlaubt diese Redundanz der zentralen Repräsentation des
Sinnesrasens eine - zumindest teilweise - Kompensation des Ausfalls von Afferenzen.
Kommt es z.B. zu einer begrenzten Ischämie in einem sensiblen Nerv,
fallen zwar einige afferente Nervenfasern aus und die Qualität der Informationsübertragung leidet, die betroffene Stelle
(z.B. Haut) wird aber noch nicht gefühllos, soferne der Defekt durch
funktionierende Überlappungszonen kompensiert werden kann. im Brustbereich jeweils zur Hälfte, Ausfall eines
Interkostalnerven kann sensorisch weitgehend kompensiert werden.
im Brustbereich jeweils zur Hälfte, Ausfall eines
Interkostalnerven kann sensorisch weitgehend kompensiert werden.
 Abbildung: Rezeptive Felder für unterschiedliche Sinnesqualitäten differieren in ihrer Größe
Abbildung: Rezeptive Felder für unterschiedliche Sinnesqualitäten differieren in ihrer Größe
 Abbildung zeigt an einem Beispiel, dass sich die Größe
rezeptiver Felder für verschiedene Sinnesqualitäten auf ein und
derselben Sinnesprojektionsfläche (hier die Haut einer Hand) deutlich
unterscheiden kann: Die kolorierten Flächen zeigen die Größe der (hier
angenommenen) rezeptiven Felder eines Neurons für
Berührungssensitivität (blau), eines anderen für Vibration (grün),
wieder eines anderen Neurons für Wärme (gelb) und schließlich eines für
Schmerz (rot). Die Projektionsflächen (rezeptiven Felder) für
Mechanosensibilität sind klein, diejenigen für Wärme- und Schmerzsensibilität größer. Berührungs- und Vibrationsreize sind gut
lokalisierbar, die Ortung von Wärme- oder Schmerzreizen
(oder auch Juckreizen) fällt schwerer (geringe räumliche Auflösung).
Abbildung zeigt an einem Beispiel, dass sich die Größe
rezeptiver Felder für verschiedene Sinnesqualitäten auf ein und
derselben Sinnesprojektionsfläche (hier die Haut einer Hand) deutlich
unterscheiden kann: Die kolorierten Flächen zeigen die Größe der (hier
angenommenen) rezeptiven Felder eines Neurons für
Berührungssensitivität (blau), eines anderen für Vibration (grün),
wieder eines anderen Neurons für Wärme (gelb) und schließlich eines für
Schmerz (rot). Die Projektionsflächen (rezeptiven Felder) für
Mechanosensibilität sind klein, diejenigen für Wärme- und Schmerzsensibilität größer. Berührungs- und Vibrationsreize sind gut
lokalisierbar, die Ortung von Wärme- oder Schmerzreizen
(oder auch Juckreizen) fällt schwerer (geringe räumliche Auflösung).
 Abbildung: Retinotopie
Abbildung: Retinotopie
 (Körper), Retinotopie (Netzhaut -
(Körper), Retinotopie (Netzhaut -  Abbildung) und Tonotopie (Tonhöhe) spricht.
Abbildung) und Tonotopie (Tonhöhe) spricht.
 Vorwärts- und
Rückwärtshemmung,
Vorwärts- und
Rückwärtshemmung, 
 Dämpfung, und
Dämpfung, und 
 Kontrastierung (laterale Hemmung, Umfeldhemmung), je nach Verschaltungsmuster und Funktion.
Kontrastierung (laterale Hemmung, Umfeldhemmung), je nach Verschaltungsmuster und Funktion.
 Sinnesreize können inadäquat oder adäquat (Reizart), unter- oder
überschwellig sein (Reizintensität). Sie bewirken an Sinneszellen eine
Änderung des Membranpotentials (Transduktion). Diese Änderung nennt man
Sensorpotential, Rezeptorpotential oder Generatorpotential, sie erfolgt
mittels spezialisierter (mechano-, chemo-, photosensibler)
Membranproteine
Sinnesreize können inadäquat oder adäquat (Reizart), unter- oder
überschwellig sein (Reizintensität). Sie bewirken an Sinneszellen eine
Änderung des Membranpotentials (Transduktion). Diese Änderung nennt man
Sensorpotential, Rezeptorpotential oder Generatorpotential, sie erfolgt
mittels spezialisierter (mechano-, chemo-, photosensibler)
Membranproteine Besteht das Rezeptorpotential in einer ausreichend starken
(überschwelligen) Depolarisierung, entsteht ein Aktionspotential. Mit
zunehmender Reduktion des Membranpotentials am Rezeptor steigt die
Aktionspotentialfrequenz, mit zunehmender Hyperpolarisierung nimmt sie
ab
Besteht das Rezeptorpotential in einer ausreichend starken
(überschwelligen) Depolarisierung, entsteht ein Aktionspotential. Mit
zunehmender Reduktion des Membranpotentials am Rezeptor steigt die
Aktionspotentialfrequenz, mit zunehmender Hyperpolarisierung nimmt sie
ab Afferente Nervenfasern können auf einen Reiz direkt mit veränderter
Erregungsgröße (Aktionspotentialfrequenz) reagieren (Druck, Schmerz,
Temperatur, Geruch). Ändern sekundäre Sinneszellen ihre
Transmitterfreisetzung, ändert sich die Erregungsgröße afferenter
Nervenfasern (Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn)
Afferente Nervenfasern können auf einen Reiz direkt mit veränderter
Erregungsgröße (Aktionspotentialfrequenz) reagieren (Druck, Schmerz,
Temperatur, Geruch). Ändern sekundäre Sinneszellen ihre
Transmitterfreisetzung, ändert sich die Erregungsgröße afferenter
Nervenfasern (Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn) Absolutschwelle ist die Reizstärke, die gerade noch eine Empfindung
auslöst, Unterschiedsschwelle eine Änderung der Reizstärke, die gerade
noch eine Empfindungsänderung hervorruft. Die Unterschiedsschwelle ist ein
meist konstanter Bruchteil (Weber-Gesetz: ΔR / R) des Betrags des
Bezugsreizes (ein vom Absolutbetrag des Reizes unabhängiger Quotient)
Absolutschwelle ist die Reizstärke, die gerade noch eine Empfindung
auslöst, Unterschiedsschwelle eine Änderung der Reizstärke, die gerade
noch eine Empfindungsänderung hervorruft. Die Unterschiedsschwelle ist ein
meist konstanter Bruchteil (Weber-Gesetz: ΔR / R) des Betrags des
Bezugsreizes (ein vom Absolutbetrag des Reizes unabhängiger Quotient) Sinneserlebnisse unterscheiden sich nach Lokalisation, Ausdehnung, Richtung, Intensität, Zeitverlauf und Qualität. Modalität
ist ein "Qualitätskreis", der subjektiv "besonders" und nicht mit einem
anderen vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Modalitäten sind durch
ihren Sinneskanal (z.B. Sehnerv - Hörnerv) und ihre Hirnregion (z.B.
Sehrinde - Hörrinde) bestimmt Sinneserlebnisse unterscheiden sich nach Lokalisation, Ausdehnung, Richtung, Intensität, Zeitverlauf und Qualität. Modalität
ist ein "Qualitätskreis", der subjektiv "besonders" und nicht mit einem
anderen vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Modalitäten sind durch
ihren Sinneskanal (z.B. Sehnerv - Hörnerv) und ihre Hirnregion (z.B.
Sehrinde - Hörrinde) bestimmt Überschwellige Reize verändern das Erregungsmuster der afferenten
Fasern, unterschwellige nicht. Auf adäquate Reize reagieren
entsprechende Rezeptorzellen sehr empfindlich (sie sind auf die
Verarbeitung solcher Reize spezialisiert), auf inadäquate nur bei sehr
hoher Reizstärke (z.B. Schlag aufs Auge)
Überschwellige Reize verändern das Erregungsmuster der afferenten
Fasern, unterschwellige nicht. Auf adäquate Reize reagieren
entsprechende Rezeptorzellen sehr empfindlich (sie sind auf die
Verarbeitung solcher Reize spezialisiert), auf inadäquate nur bei sehr
hoher Reizstärke (z.B. Schlag aufs Auge) Proportionalverhalten bedeutet 1:1-Abbildung des Reizes in der
Erregungsgröße (ohne Adaptation, z.B. Schmerzrezeptoren), bei
Differentialverhalten adaptatiert sie während der Reizeinwirkung (z.B.
Vibrationssensoren). Die meisten Sinnessysteme zeigen kombiniertes (PD-)
Verhalten, mit verschieden stark ausgeprägtem Proportional- und
Differentialanteil
Proportionalverhalten bedeutet 1:1-Abbildung des Reizes in der
Erregungsgröße (ohne Adaptation, z.B. Schmerzrezeptoren), bei
Differentialverhalten adaptatiert sie während der Reizeinwirkung (z.B.
Vibrationssensoren). Die meisten Sinnessysteme zeigen kombiniertes (PD-)
Verhalten, mit verschieden stark ausgeprägtem Proportional- und
Differentialanteil Ein rezeptives Gebiet, dessen Sinnesinformation jeweils zu einer
afferenten Nervenzelle konvergiert, nennt man deren rezeptives Feld.
Die Größe rezeptiver Felder in einem bestimmten Sinnesorgan verhält
sich umgekehrt proportional zum räumlichen Auflösungsvermögen.
Aneinandergrenzende rezeptive Felder zeigen meist laterale Hemmung
(Kontrastverstärkung). Rezeptive Felder überschneiden sich, wenn
Rezeptorzellen mehreren rezeptiven Feldern zugeordnet sind (Divergenz).
Wenn Nervenzellen im ZNS Impulse von mehreren Rezeptoren erhalten,
spricht man von Konvergenz
Ein rezeptives Gebiet, dessen Sinnesinformation jeweils zu einer
afferenten Nervenzelle konvergiert, nennt man deren rezeptives Feld.
Die Größe rezeptiver Felder in einem bestimmten Sinnesorgan verhält
sich umgekehrt proportional zum räumlichen Auflösungsvermögen.
Aneinandergrenzende rezeptive Felder zeigen meist laterale Hemmung
(Kontrastverstärkung). Rezeptive Felder überschneiden sich, wenn
Rezeptorzellen mehreren rezeptiven Feldern zugeordnet sind (Divergenz).
Wenn Nervenzellen im ZNS Impulse von mehreren Rezeptoren erhalten,
spricht man von Konvergenz Im Gehirn erfolgt die Abbildung geordnet nach Modalitäten und Orten
(Körper: Somatotopie, Netzhaut: Retinotopie, Tonhöhe: Tonotopie).
Bewusste Wahrnehmung wird von der Aufmerksamkeit gesteuert.
Inhibitorische Verschaltungen sind die Grundlage von Dämpfung,
Kontrastierung, Vorwärts- und Rückwärtshemmung
Im Gehirn erfolgt die Abbildung geordnet nach Modalitäten und Orten
(Körper: Somatotopie, Netzhaut: Retinotopie, Tonhöhe: Tonotopie).
Bewusste Wahrnehmung wird von der Aufmerksamkeit gesteuert.
Inhibitorische Verschaltungen sind die Grundlage von Dämpfung,
Kontrastierung, Vorwärts- und Rückwärtshemmung |
