




| Die Otolithenorgane - die etwa senkrecht zueinander positionierten macula sacculi und
utriculi - sprechen auf geradlinige Beschleunigung an. Die in einer Schleimschicht befindlichen Otolithen
(Statolithen) haben aufgrund ihres Kalkgehaltes eine größere
Massendichte, und widerstehen einer Beschleunigung stärker, als ihre
Umgebung.
Sie sind an Zilien (Härchen) der Haarzellen fixiert und ermöglichen ihnen die Detektion von Kräften, die Zilien seitlich abwinkeln. So zeigen sie der
Sensomotorik an, wo oben und unten ist oder welche zusätzlichen Beschleunigungskräfte einwirken (das Gehirn verfügt über eine präzise "Karte" der Orientierung der Zilien in den Maculae). Das dient der Orientierung des
Körpers im Raum (statisch - Schwerkraft, dynamisch - auf den Kopf wirkende geradlinige Beschleunigung). Motorische Programme werden durch Proprio- und Exterozeption (optisch, akustisch, mechanisch) kontrolliert und modifiziert. Insbesondere Kleinhirn und Hirnstammkerne benötigen Information aus den Otolithenorganen, um aufrechte Haltung und Bewegung zu koordinieren und zu stabilisieren. Jeder der sechs Bogengänge steht im Kopf in einer anderen Ebene. Die Endolymphe in ihnen wird durch Drehbewegungen des Kopfes beschleunigt (Coriolis-Effekt), und die Erregungsgröße der Haarzellen in den Ampullen wird dadurch verändert (je nach Richtung abgeschwächt oder verstärkt - wie in den Otolithenorganen). So erhält das Gehirn präzise Information über Drehbewegungen bzw. Veränderungen der Kopfposition. Insbesondere die Augenmuskelkerne werden angesteuert, sodass Kopfdrehungen automatisch Gegendrehungen der Augen bewirken (Folgebewegungen) und das Abbild der Umgebung auf der Netzhaut stabil bleibt. Registrierungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme. Diese können unterschiedlich erfolgen, z.B. mittels optischer Systeme. Der Augapfel hat ein elektrisches Potential (~1 mV), und okulomotorische Bewegungen führen in der Umgebung des Auges zu Potentialschwankungen, die mit Elektroden von der Haut abgegriffen werden können (Elektro-Okulographie, EOG). Die elektrische Ableitung von Nystagmen (Hin- und Herbewegungen der Augen) heißt Elektronystagmographie (ENG). |
 Makulasystem
Makulasystem  Haarzellen
Haarzellen  Bogengangssystem
Bogengangssystem  Funktion
Funktion  Zentrale Verschaltungen
Zentrale Verschaltungen  Okulo- und Nystagmographie
Okulo- und Nystagmographie Nystagmus
Nystagmus  Sakkaden
Sakkaden
 Core messages
Core messages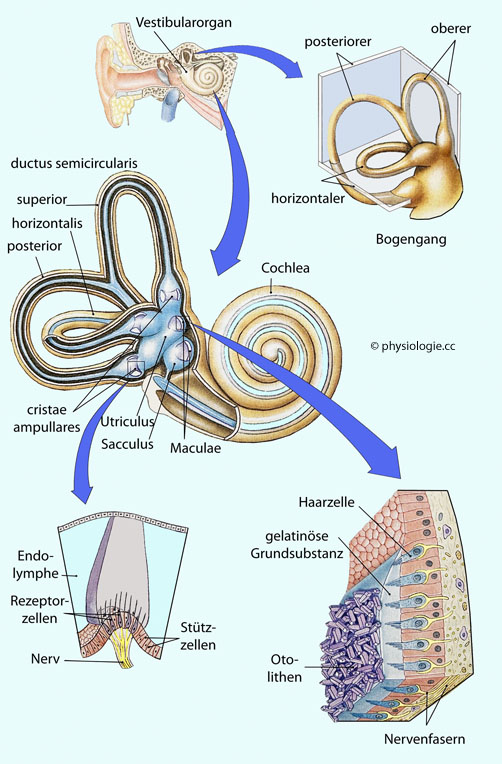
 Abbildung: Anatomie des Vestibularsystems
Abbildung: Anatomie des Vestibularsystems
 ,
sowie drei Cupulaorgane in den Bogengangsampullen. Der N. vestibularis superior innerviert den anterioren und horizontalen, der N. vestibularis inferior den posterioren Bogengang und die Makulaorgane. Die vom N. vestibularis superior innervierten Gebiete werden durch die A. vestibularis anterior versorgt, die vom N. vestibularis inferior innervierten von der A. vestibularis posterior. Die Makulaorgane
detektieren lineare, die Cupulaorgane Drehbeschleunigungen.
,
sowie drei Cupulaorgane in den Bogengangsampullen. Der N. vestibularis superior innerviert den anterioren und horizontalen, der N. vestibularis inferior den posterioren Bogengang und die Makulaorgane. Die vom N. vestibularis superior innervierten Gebiete werden durch die A. vestibularis anterior versorgt, die vom N. vestibularis inferior innervierten von der A. vestibularis posterior. Die Makulaorgane
detektieren lineare, die Cupulaorgane Drehbeschleunigungen.
 Abbildung: Lage der Innenohrorgane
Abbildung: Lage der Innenohrorgane
 (Abbildungen) detektiert geradlinige Beschleunigungen (Linearbeschleunigung). Im
Innenohr befinden sich die macula sacculi und macula utriculi (Otolithenorgane), sie registrieren Richtung und Größe von Längsbeschleunigungen, die auf den
Körper einwirken.
(Abbildungen) detektiert geradlinige Beschleunigungen (Linearbeschleunigung). Im
Innenohr befinden sich die macula sacculi und macula utriculi (Otolithenorgane), sie registrieren Richtung und Größe von Längsbeschleunigungen, die auf den
Körper einwirken. 
 Abbildung:
Das Otolithensystem
Abbildung:
Das Otolithensystem  zur Oben-Unten-Wahrnehmung
zur Oben-Unten-Wahrnehmung Abbildung): Abwinkelung vom längsten Zilium weg wirkt
hyperpolarisierend (inhibierend), zum längsten Zilium hin
depolarisierend (anregend)
Abbildung): Abwinkelung vom längsten Zilium weg wirkt
hyperpolarisierend (inhibierend), zum längsten Zilium hin
depolarisierend (anregend)

 Abbildung: Striola
Abbildung: Striola
 Abbildung).
Abbildung).| Neigt man den Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach ihrer Position |

 s. weiter unten).
s. weiter unten).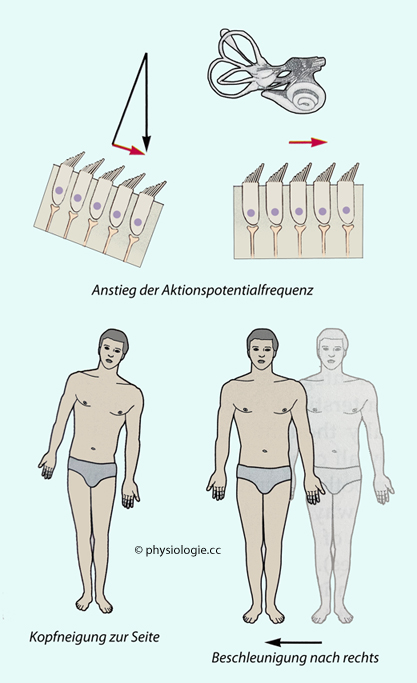
 Abbildung: Mögliche Zweideutigkeit von Makulasignalen
Abbildung: Mögliche Zweideutigkeit von Makulasignalen
 +Gx bedeutet, dass die inneren Organe nach dorsal
drücken (Beschleunigung des Körpers nach ventral) - -Gx beschleunigt
umgekehrt innere Organe nach ventral (Beschleunigung des Körpers nach
dorsal)
+Gx bedeutet, dass die inneren Organe nach dorsal
drücken (Beschleunigung des Körpers nach ventral) - -Gx beschleunigt
umgekehrt innere Organe nach ventral (Beschleunigung des Körpers nach
dorsal) Beispiel: +Gx beim Anfahren, -Gx beim Bremsen
Beispiel: +Gx beim Anfahren, -Gx beim Bremsen +Gy bedeutet, dass die inneren Organe nach links drücken (Beschleunigung des Körpers nach rechts) - -Gy beschleunigt Organe nach rechts (Beschleunigung des Körpers nach links)
+Gy bedeutet, dass die inneren Organe nach links drücken (Beschleunigung des Körpers nach rechts) - -Gy beschleunigt Organe nach rechts (Beschleunigung des Körpers nach links) Seitwärtsbeschleunigung
kann von Innenohr sowohl bei Schiefstellung des Kopfes als auch bei
seitlicher Beschleunigung des ganzen Köerpers detektiert werden
(
Seitwärtsbeschleunigung
kann von Innenohr sowohl bei Schiefstellung des Kopfes als auch bei
seitlicher Beschleunigung des ganzen Köerpers detektiert werden
( Abbildung)
Abbildung) +Gz bedeutet, dass die inneren Organe nach kaudal drücken (Beschleunigung des Körpers nach kranial) - -Gz beschleunigt Organe nach kranial (Beschleunigung des Körpers nach kaudal)
+Gz bedeutet, dass die inneren Organe nach kaudal drücken (Beschleunigung des Körpers nach kranial) - -Gz beschleunigt Organe nach kranial (Beschleunigung des Körpers nach kaudal) Beispiel: +Gz im Stehen, -Gz bei Kopfstand
Beispiel: +Gz im Stehen, -Gz bei Kopfstand
 Abbildung: Haarzellen (Vestibularsystem)
Abbildung: Haarzellen (Vestibularsystem)
 etwa 100 (50-150) Stereozilien (korrektere Bezeichnung: Stereovilli - ähnlich Mikrovilli, deren Spitzen über elastische Brücken (tip links) verbunden sind - 0,2 bis 0,8 µm dick und 4 bis 10 µm lang (je näher am Kinozilium, desto länger) - und
etwa 100 (50-150) Stereozilien (korrektere Bezeichnung: Stereovilli - ähnlich Mikrovilli, deren Spitzen über elastische Brücken (tip links) verbunden sind - 0,2 bis 0,8 µm dick und 4 bis 10 µm lang (je näher am Kinozilium, desto länger) - und  ein Kinozilium (ein echtes Zilium mit Mikrotubuli - 9
peripheren und 2 zentralen).
ein Kinozilium (ein echtes Zilium mit Mikrotubuli - 9
peripheren und 2 zentralen). 
 Abbildung: Mechanotransduktion an einer Haarzelle
Abbildung: Mechanotransduktion an einer Haarzelle
 Abbildung).
Abbildung). Abbildung); die englischen
Bezeichnungen roll (Sagittalachse X), pitch (Transversalachse Y) und yaw (Longitudinalachse Z) werden auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet.
Abbildung); die englischen
Bezeichnungen roll (Sagittalachse X), pitch (Transversalachse Y) und yaw (Longitudinalachse Z) werden auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet.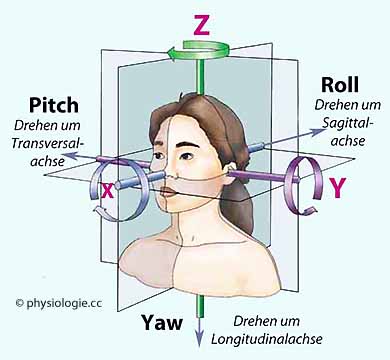
 Abbildung: Beschleunigungs- bzw. Drehachsen
Abbildung: Beschleunigungs- bzw. Drehachsen
| Kopfdrehung führt zu Depolarisation einiger Haarzellen und erhöhter Aktionspotentialfrequenz der Afferenzen, an anderen Haarzellen zu Hyperpolarisierung und Frequenzabfall - je nach Position |
 s. dort.
s. dort.
 Abbildung: Horizontale Kopfdrehungen werden von den horizontalen Bogengängen registriert
Abbildung: Horizontale Kopfdrehungen werden von den horizontalen Bogengängen registriert
 Der ungarisch-österreichische Otologe Robert Bárány
erhielt 1916 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine
"Arbeiten über Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates". Er
untersuchte u.a. den kalorischen Nystagmus, der eine seitengetrennte
Untersuchung des Vestibularapparates ermöglicht. Er stellte die
Hypothese auf, dass den ausgelösten Vergenzen des Augapfels ein Aufsteigen erwärmter, bzw. Absinken abgekühlter Endolymphe im lateralen Bogengang zugrunde liegt.
Der ungarisch-österreichische Otologe Robert Bárány
erhielt 1916 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine
"Arbeiten über Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates". Er
untersuchte u.a. den kalorischen Nystagmus, der eine seitengetrennte
Untersuchung des Vestibularapparates ermöglicht. Er stellte die
Hypothese auf, dass den ausgelösten Vergenzen des Augapfels ein Aufsteigen erwärmter, bzw. Absinken abgekühlter Endolymphe im lateralen Bogengang zugrunde liegt.
 Abbildung: Bogengangsystem
Abbildung: Bogengangsystem
 Unter einem Nystagmus Unter einem Nystagmus  versteht man das konsekutive Hin- und
Herbewegen der Augen (horizontal oder vertikal) versteht man das konsekutive Hin- und
Herbewegen der Augen (horizontal oder vertikal) |
 lateralis (Deiters-Kern), der wichtigste Koordinationskern für das Gleichgewicht
lateralis (Deiters-Kern), der wichtigste Koordinationskern für das Gleichgewicht medialis (Schwalbe-Kern)
medialis (Schwalbe-Kern) superior (rostralis; Bechterew-Kern)
superior (rostralis; Bechterew-Kern) inferior (caudalis, descending; Roller-Kern)
inferior (caudalis, descending; Roller-Kern)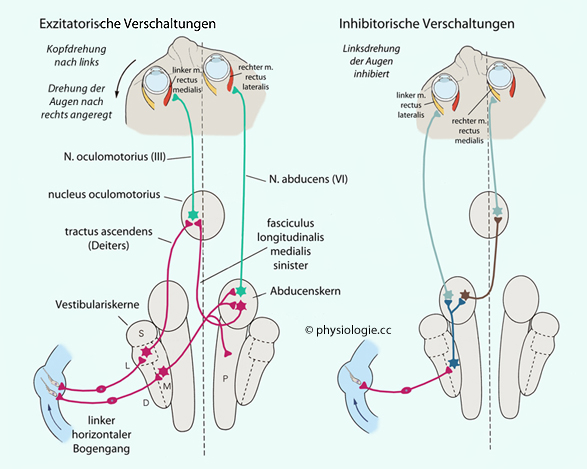
 Abbildung: Horizontale Vergenz und vestibulo-okulärer Reflex
Abbildung: Horizontale Vergenz und vestibulo-okulärer Reflex
 Abbildung oben). Die Signale
aus dem Innenohr werden neural nachbearbeitet, um adäquate
Augenbewegungen auszulösen und diese auch (bei nachlassendem
Innenohrsignal) zu stabilisieren (neuraler Integrator).
Abbildung oben). Die Signale
aus dem Innenohr werden neural nachbearbeitet, um adäquate
Augenbewegungen auszulösen und diese auch (bei nachlassendem
Innenohrsignal) zu stabilisieren (neuraler Integrator).  Über die Steuerung von Augenbewegungen durch Kleinhirn, Hirnstamm und Großhirn s. dort
Über die Steuerung von Augenbewegungen durch Kleinhirn, Hirnstamm und Großhirn s. dort Sakkaden Sakkaden  sind ruckartige Augenbewegungen, wie sie bei Neueinstellung des Fixationspunktes (z.B. beim Lesen) auftreten sind ruckartige Augenbewegungen, wie sie bei Neueinstellung des Fixationspunktes (z.B. beim Lesen) auftreten |
 Abbildung):
Abbildung):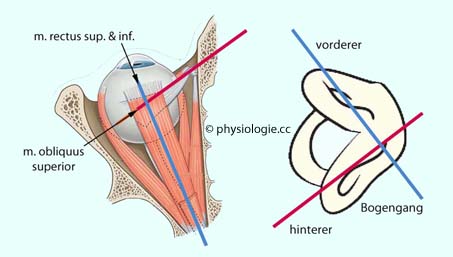
 Abbildung: Zugrichtung von Augenmuskeln vs. Position von Bogengängen (linke Schädelhälfte, Blick von oben)
Abbildung: Zugrichtung von Augenmuskeln vs. Position von Bogengängen (linke Schädelhälfte, Blick von oben)
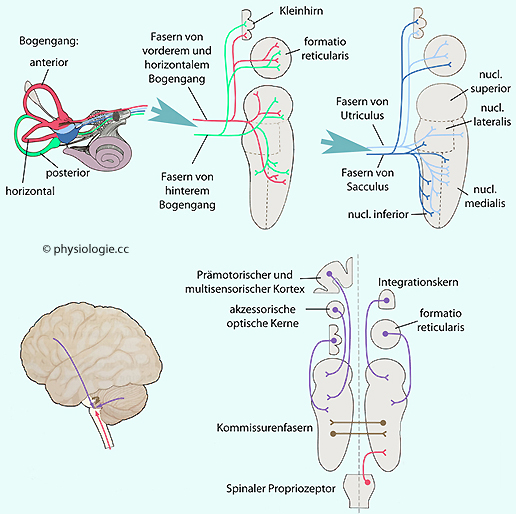
 Abbildung: Afferenzen zu den Vestibulariskernen und zentrale Projektionen
Abbildung: Afferenzen zu den Vestibulariskernen und zentrale Projektionen
 Abbildung), über die gegenläufige Reizmuster
aus dem Gleichgewichtsorgan abschwächend auf entsprechende
Neuronengruppen der Gegenseite wirken und so vestibuläre
Beschleunigungsinformationen indirekt verstärken (z.B. bewirkt eine
Anregung aus einem der horizontalen Bogengänge eine Abschwächung des
kontralateralen Bogengangkanals - "push-pull".
Ähnliches gilt für das Funktionspaar anteriorer Bogengang der einen
Seite und posteriorer der Gegenseite). Das Resultat ist eine
Verstärkung des jeweiligen Signals und ein automatischer Abgleich der
beiden Informationskanäle.
Abbildung), über die gegenläufige Reizmuster
aus dem Gleichgewichtsorgan abschwächend auf entsprechende
Neuronengruppen der Gegenseite wirken und so vestibuläre
Beschleunigungsinformationen indirekt verstärken (z.B. bewirkt eine
Anregung aus einem der horizontalen Bogengänge eine Abschwächung des
kontralateralen Bogengangkanals - "push-pull".
Ähnliches gilt für das Funktionspaar anteriorer Bogengang der einen
Seite und posteriorer der Gegenseite). Das Resultat ist eine
Verstärkung des jeweiligen Signals und ein automatischer Abgleich der
beiden Informationskanäle. von der Somatosensorik
von der Somatosensorik vom visuellen System
vom visuellen System vom Kleinhirn.
vom Kleinhirn. Abbildung oben). Das ermöglicht Beiträge zur räumlichen
Orientierung wie auch reflektorische Einflüsse auf Kreislauf
(Blutdruck, Herzfrequenz), Atmung und andere Systeme.
Abbildung oben). Das ermöglicht Beiträge zur räumlichen
Orientierung wie auch reflektorische Einflüsse auf Kreislauf
(Blutdruck, Herzfrequenz), Atmung und andere Systeme.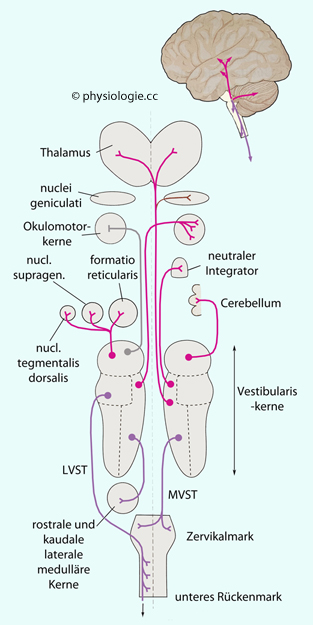
 Abbildung: Projektionen aus den Vestibulariskernen
Abbildung: Projektionen aus den Vestibulariskernen
 Abbildung) gelangen an folgende
Adressaten:
Abbildung) gelangen an folgende
Adressaten: Thalamus und Großhirn (Lagewahrnehmung)
Thalamus und Großhirn (Lagewahrnehmung) Hypothalamus (vegetative Reaktionen)
Hypothalamus (vegetative Reaktionen) Augenmuskelkerne (vestibulo-okuläre Reflexe)
Augenmuskelkerne (vestibulo-okuläre Reflexe) Kleinhirn (Moosfasern). Der vom vestibulären System ausgehende vestibulo-okuläre Reflex
wird durch das Kleinhirn adjustiert - immer, wenn ein Missverhältnis
zwischen der Größe einer Kopfdrehung einerseits, und der Amplitude der kompensatorischen
Augenbewegung andererseits auftritt (motorisches Lernen). Die Reflexschleife läuft über
Vestibulariskerne → Moosfasern → Körnerzellen → Purkinjezellen → Vestibulariskerne; Fehlersignale gelangen über Kletterfasern zum Kleinhirn (vgl. dort)
Kleinhirn (Moosfasern). Der vom vestibulären System ausgehende vestibulo-okuläre Reflex
wird durch das Kleinhirn adjustiert - immer, wenn ein Missverhältnis
zwischen der Größe einer Kopfdrehung einerseits, und der Amplitude der kompensatorischen
Augenbewegung andererseits auftritt (motorisches Lernen). Die Reflexschleife läuft über
Vestibulariskerne → Moosfasern → Körnerzellen → Purkinjezellen → Vestibulariskerne; Fehlersignale gelangen über Kletterfasern zum Kleinhirn (vgl. dort) Motorische Vorderhornzellen (Gleichgewichtsreflexe)
Motorische Vorderhornzellen (Gleichgewichtsreflexe) Andere Vestibulariskerne (Seitenvergleich u.a.)
Andere Vestibulariskerne (Seitenvergleich u.a.) Abbildung) - zu
motorischen Vorderhornzellen entlang der gesamten Länge des
Rückenmarks; auch projiziert er intensiv auf die formatio reticularis.
Abbildung) - zu
motorischen Vorderhornzellen entlang der gesamten Länge des
Rückenmarks; auch projiziert er intensiv auf die formatio reticularis. Abbildung) - das Rückenmark.
Abbildung) - das Rückenmark. Abbildung). Solche Verschaltungen helfen bei der Stabilisierung des Blicks auf betrachtete Gegenstände.
Abbildung). Solche Verschaltungen helfen bei der Stabilisierung des Blicks auf betrachtete Gegenstände.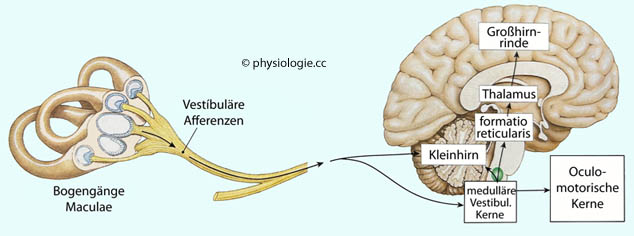
 Abbildung: Blickstabilisierende Projektionen in das Kleinhirn
Abbildung: Blickstabilisierende Projektionen in das Kleinhirn
 Abbildung).
Abbildung).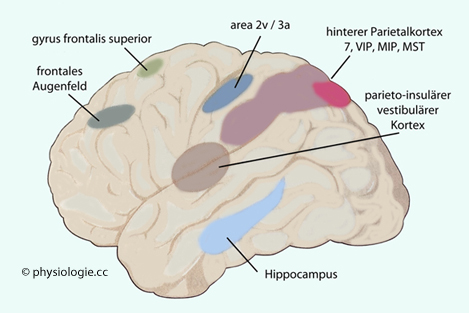
 Abbildung: Kortexareale, auf die sich vestibuläre Information auswirkt
Abbildung: Kortexareale, auf die sich vestibuläre Information auswirkt
 Aufzeichnungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme
(EOG = Elektrookulographie
Aufzeichnungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme
(EOG = Elektrookulographie  ). Man nützt die Tatsache aus, dass das Auge
ein elektrischer Dipol ist (vorne positiv, ~1 mV: korneo-retinales Potenzial); Bewegungen des
Augapfels verändern die Lage elektrischer Feldlinien an der Haut
(Schläfe, Nasenrücken), von wo man Potentialänderungen ableitet und mit
Augenbewegungen in Beziehung setzen kann.
). Man nützt die Tatsache aus, dass das Auge
ein elektrischer Dipol ist (vorne positiv, ~1 mV: korneo-retinales Potenzial); Bewegungen des
Augapfels verändern die Lage elektrischer Feldlinien an der Haut
(Schläfe, Nasenrücken), von wo man Potentialänderungen ableitet und mit
Augenbewegungen in Beziehung setzen kann.  Abbildung).
Abbildung).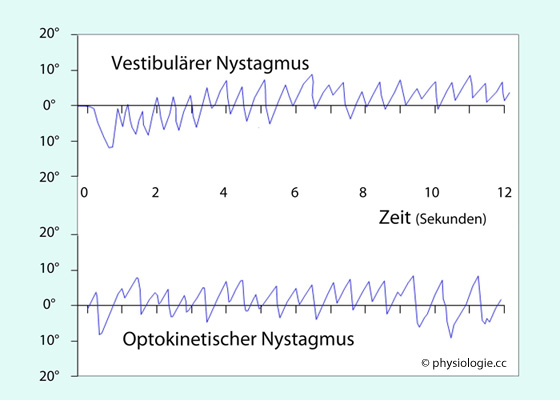
 Abbildung: Registrierung eines vestibulären (oben) und eines optokinetischen Nystagmus (unten)
Abbildung: Registrierung eines vestibulären (oben) und eines optokinetischen Nystagmus (unten)
 Nystagmogramme (ENG = Elektronystagmographie -
Nystagmogramme (ENG = Elektronystagmographie -  Abbildung)
zeichnen "hin- und hergerichtete" Augenbewegungen auf:
Abbildung)
zeichnen "hin- und hergerichtete" Augenbewegungen auf:  Ruckartige
Stellbewegungen (Sakkaden) und
Ruckartige
Stellbewegungen (Sakkaden) und  glatte Verfolgebewegungen
(durch das Bogengangsystem und / oder optisch hervorgerufene Vergenzen
- diese entstehen reflektorisch, nicht willkürlich).
glatte Verfolgebewegungen
(durch das Bogengangsystem und / oder optisch hervorgerufene Vergenzen
- diese entstehen reflektorisch, nicht willkürlich).
| Zu Beginn einer Rotation tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf Bei Abstoppen der Rotation kommt es zu Nystagmus zur Gegenseite (postrotatorisch) |
 Maculasystem (Utriculus, Sacculus)
Maculasystem (Utriculus, Sacculus) Cupulasystem (Bogengänge)
Cupulasystem (Bogengänge)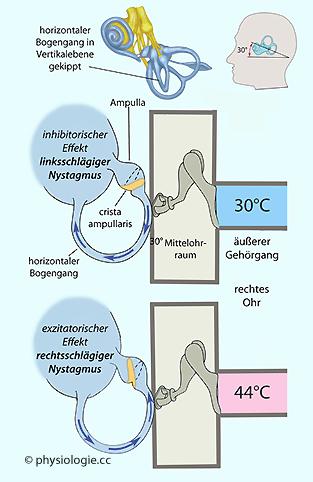
 Abbildung: Bithermale Testung des kalorischen Nystagmus
Abbildung: Bithermale Testung des kalorischen Nystagmus
 Abbildung), weil dabei die Endolymphe im seitlichen
Bogengang zu thermisch-konvektiver Strömung angeregt wird - am
stärksten bei um 60° nach oben geneigtem Kopf.
Abbildung), weil dabei die Endolymphe im seitlichen
Bogengang zu thermisch-konvektiver Strömung angeregt wird - am
stärksten bei um 60° nach oben geneigtem Kopf.  Treten
widersprüchliche Sinnesmeldungen vom Gleichgewichtssinn einerseits, vom
Gesichtssinn andererseits auf, kann es im Rahmen von
“Bewegungskrankheiten” (Kinetosen
Treten
widersprüchliche Sinnesmeldungen vom Gleichgewichtssinn einerseits, vom
Gesichtssinn andererseits auf, kann es im Rahmen von
“Bewegungskrankheiten” (Kinetosen  - “Seekrankheit”, “Flugkrankheit”) zu
vegetativen Reaktionen (Übelkeit, Blässe, Schweißausbruch, Erbrechen)
kommen.
- “Seekrankheit”, “Flugkrankheit”) zu
vegetativen Reaktionen (Übelkeit, Blässe, Schweißausbruch, Erbrechen)
kommen. 
 Abbildung: Mit Muskelkraft betriebene Humanzentrifuge
Abbildung: Mit Muskelkraft betriebene Humanzentrifuge

 Das Makulasystem des Innenohres (Otolithenorgane: macula sacculi,
macula utriculi) misst Richtung und Größe von geradlinigen (Längs-,
Linear-) Beschleunigungen, die auf den Kopf einwirken und meldet, wo
oben und unten ist (Gravitationsrezeptoren). Einwirkende
Kräfte werden nach Koordinaten benannt: +Gx bedeutet
Beschleunigung des Körpers nach ventral, -Gx nach dorsal, +Gy nach
rechts, -Gy nach links, +Gz nach kranial, -Gz nach kaudal. Die
Eingeweide bewegen sich in die Gegenrichtung (Trägheit beschleunigter
Masse). Ein +Gz-Effekt tritt bei aufrechtem Stehen auf, ein +Gx-Effekt
in Rückenlage
Das Makulasystem des Innenohres (Otolithenorgane: macula sacculi,
macula utriculi) misst Richtung und Größe von geradlinigen (Längs-,
Linear-) Beschleunigungen, die auf den Kopf einwirken und meldet, wo
oben und unten ist (Gravitationsrezeptoren). Einwirkende
Kräfte werden nach Koordinaten benannt: +Gx bedeutet
Beschleunigung des Körpers nach ventral, -Gx nach dorsal, +Gy nach
rechts, -Gy nach links, +Gz nach kranial, -Gz nach kaudal. Die
Eingeweide bewegen sich in die Gegenrichtung (Trägheit beschleunigter
Masse). Ein +Gz-Effekt tritt bei aufrechtem Stehen auf, ein +Gx-Effekt
in Rückenlage Maculae sind ungefähr im rechten Winkel zueinander positioniert und tragen ~20.0000-30.000 Haarzellen. Scherbewegung einer
gelartigen Matrix erregt Zilien, die in sie eintauchen; jede Kopfposition erzeugt ein
bestimmtes Erregungsmuster der Zellen im Otolithenorgan. Neigt man den
Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach Position Maculae sind ungefähr im rechten Winkel zueinander positioniert und tragen ~20.0000-30.000 Haarzellen. Scherbewegung einer
gelartigen Matrix erregt Zilien, die in sie eintauchen; jede Kopfposition erzeugt ein
bestimmtes Erregungsmuster der Zellen im Otolithenorgan. Neigt man den
Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach Position Die Dichte der Gelmatrix beträgt durch eingelagerte Calciumcarbonatkristalle (Ohrensteine, Otolithen, Otokonien,
Statolithen) 1,3-1,4 g/ml, die der Endolymphe ~1,0 g/ml. Daher werden
schräg oder senkrecht zur Beschleunigungsrichtung positionierte Maculae
angeregt. Das wirkt sich auf Membranpotential und Glutamatfreisetzung der Sinneszellen sowie
die Aktionspotentialfrequenz afferenter Nervenfasern aus: Neigung des
Kopfes ändert das Erregungsmuster der Makulaorgane und löst reflektorisch Gegenrollen
der Augen sowie somatische Korrekturbewegungen aus Die Dichte der Gelmatrix beträgt durch eingelagerte Calciumcarbonatkristalle (Ohrensteine, Otolithen, Otokonien,
Statolithen) 1,3-1,4 g/ml, die der Endolymphe ~1,0 g/ml. Daher werden
schräg oder senkrecht zur Beschleunigungsrichtung positionierte Maculae
angeregt. Das wirkt sich auf Membranpotential und Glutamatfreisetzung der Sinneszellen sowie
die Aktionspotentialfrequenz afferenter Nervenfasern aus: Neigung des
Kopfes ändert das Erregungsmuster der Makulaorgane und löst reflektorisch Gegenrollen
der Augen sowie somatische Korrekturbewegungen aus Haarzellen reagieren auf Bewegungen in einer Richtung, die durch die
Fläche Stereozilien - Kinozilium definiert ist. Jede Haarzelle verfügt
über 50-150 Stereozilien, deren Spitzen über tip links verbunden sind, und ein Kinozilium. Endolymphe und Perilymphe sind über tight-junction-Abdichtungen
zwischen Stütz- und Haarzellen voneinander getrennt. Der hohe
Kaliumgehalt der Endolymphe (stria vascularis) bewirkt bei
entsprechender Biegung der
Stereozilien Kaliumeinstrom und Depolarisierung der Haarzellen. Als
sekundäre Sinneszellen bilden sie Rezeptorpotentiale und Glutamat, das
die Aktionspotentialfrequenz postsynaptisch-afferenter Nervenzellen des
VIII. Hirnnerven steuert
Haarzellen reagieren auf Bewegungen in einer Richtung, die durch die
Fläche Stereozilien - Kinozilium definiert ist. Jede Haarzelle verfügt
über 50-150 Stereozilien, deren Spitzen über tip links verbunden sind, und ein Kinozilium. Endolymphe und Perilymphe sind über tight-junction-Abdichtungen
zwischen Stütz- und Haarzellen voneinander getrennt. Der hohe
Kaliumgehalt der Endolymphe (stria vascularis) bewirkt bei
entsprechender Biegung der
Stereozilien Kaliumeinstrom und Depolarisierung der Haarzellen. Als
sekundäre Sinneszellen bilden sie Rezeptorpotentiale und Glutamat, das
die Aktionspotentialfrequenz postsynaptisch-afferenter Nervenzellen des
VIII. Hirnnerven steuert Das Bogengangsystem - links und rechts jeweils drei aufeinander etwa
senkrecht stehende Bogengänge - detektiert Drehbeschleunigungen.
Aufgrund der unterschiedlichen Achsenlagen werden meist alle 6
Cupulae (paddelförmige Schleimfahnen) durch Bewegung der Endolymphe
gereizt. Je nach Position führt Kopfdrehung an einigen Haarzellen zu
Depolarisation, an anderen zu Hyperpolarisation. Das Gehirn
rekonstruiert aus
dem neuronalen Erregungsmuster Stärke
und Richtung der Drehbeschleunigung und exekutiert Korrektur- und
Gegenstellbewegungen von Hals-, Rumpf- und Extremitätenmuskulatur
(Haltungs- und Stellreflexe)
Das Bogengangsystem - links und rechts jeweils drei aufeinander etwa
senkrecht stehende Bogengänge - detektiert Drehbeschleunigungen.
Aufgrund der unterschiedlichen Achsenlagen werden meist alle 6
Cupulae (paddelförmige Schleimfahnen) durch Bewegung der Endolymphe
gereizt. Je nach Position führt Kopfdrehung an einigen Haarzellen zu
Depolarisation, an anderen zu Hyperpolarisation. Das Gehirn
rekonstruiert aus
dem neuronalen Erregungsmuster Stärke
und Richtung der Drehbeschleunigung und exekutiert Korrektur- und
Gegenstellbewegungen von Hals-, Rumpf- und Extremitätenmuskulatur
(Haltungs- und Stellreflexe) Funktionsüberprüfungen des Vestibularsystems erfolgen mittels Drehstuhl
und testen reflektorische Verbindungen zwischen Innenohr, Hirnstamm
und Augenmuskeln. Kopfdrehungen bewirken kompensatorische Drehung auch
geschlossener Augen, unterbrochen von gegenläufigen ruckartigen
Augenbewegungen (Sakkaden) - gesteuert von pontinen Hirnstammzentren. Nystagmus
ist ein Hin- und Herbewegen der Augen, vestibulärer Nystagmus wird
durch Drehung ausgelöst. Die verantwortlichen Zentren liegen im oberen
Hirnstammbereich, Klein- und Großhirn. Versionen sind gleichsinnige
(z.B. nach rechts), Vergenzen gegensinnige (Konvergenz, Divergenz)
seitliche Bewegungen der Augäpfel (mm. recti medialis und lateralis)
Funktionsüberprüfungen des Vestibularsystems erfolgen mittels Drehstuhl
und testen reflektorische Verbindungen zwischen Innenohr, Hirnstamm
und Augenmuskeln. Kopfdrehungen bewirken kompensatorische Drehung auch
geschlossener Augen, unterbrochen von gegenläufigen ruckartigen
Augenbewegungen (Sakkaden) - gesteuert von pontinen Hirnstammzentren. Nystagmus
ist ein Hin- und Herbewegen der Augen, vestibulärer Nystagmus wird
durch Drehung ausgelöst. Die verantwortlichen Zentren liegen im oberen
Hirnstammbereich, Klein- und Großhirn. Versionen sind gleichsinnige
(z.B. nach rechts), Vergenzen gegensinnige (Konvergenz, Divergenz)
seitliche Bewegungen der Augäpfel (mm. recti medialis und lateralis) Vestibulookuläre Reflexe
(VOR) sind von den Bogengängen ausgehende Reflexe, sie steuern
Kompensationsbewegungen der Augen bei Kopfdrehungen und halten das
Netzhautbild stabil. Die Drehachse kann vertikal (Kopfschütteln),
horizontal (Nicken) oder sagittal (seitliches Kippen des Kopfes)
liegen, dementsprechend unterscheidet man translatorische und
Rotations-VOR. Bewegten Gegenständen folgt das Auge mit glatten
Folgebewegungen (willkürlich lassen sich solche nicht auslösen), um den
Fixationspunkt auf der Netzhaut nicht zu verlieren. Durch Serien von
Nachfolgebewegungen und Sakkaden tritt optokinetischer Nystagmus auf Vestibulookuläre Reflexe
(VOR) sind von den Bogengängen ausgehende Reflexe, sie steuern
Kompensationsbewegungen der Augen bei Kopfdrehungen und halten das
Netzhautbild stabil. Die Drehachse kann vertikal (Kopfschütteln),
horizontal (Nicken) oder sagittal (seitliches Kippen des Kopfes)
liegen, dementsprechend unterscheidet man translatorische und
Rotations-VOR. Bewegten Gegenständen folgt das Auge mit glatten
Folgebewegungen (willkürlich lassen sich solche nicht auslösen), um den
Fixationspunkt auf der Netzhaut nicht zu verlieren. Durch Serien von
Nachfolgebewegungen und Sakkaden tritt optokinetischer Nystagmus auf Der Gleichgewichtssinn ist zusammen mit Sehen, Hören, somatischer und
Tiefensensibilität Teil des Orientierungssystems. ~19.000 Neurone im
ganglion vestibulare projizieren auf Vestibulariskerne, den
flocculonodulären Teil des Kleinhirns, Thalamus und Großhirn
(Lagewahrnehmung), Hypothalamus (vegetative Reaktionen) und motorische
Vorderhornzellen. Sie steuern Okulo- (vestibulo-okuläre Reflexe) und
spinale Motorik (Gleichgewichtsreflexe) und erhalten somatosensible,
visuelle und Kleinhirnafferenzen
Der Gleichgewichtssinn ist zusammen mit Sehen, Hören, somatischer und
Tiefensensibilität Teil des Orientierungssystems. ~19.000 Neurone im
ganglion vestibulare projizieren auf Vestibulariskerne, den
flocculonodulären Teil des Kleinhirns, Thalamus und Großhirn
(Lagewahrnehmung), Hypothalamus (vegetative Reaktionen) und motorische
Vorderhornzellen. Sie steuern Okulo- (vestibulo-okuläre Reflexe) und
spinale Motorik (Gleichgewichtsreflexe) und erhalten somatosensible,
visuelle und Kleinhirnafferenzen Okulogramme (EOG = Elektrookulographie) sind Aufzeichnungen der
Augenbewegungen (Auge als elektrischer Dipol - vorne positiv, ~1 mV
korneo-retinales Potenzial, Ableitung von Schläfe und Nasenrücken).
Eine spezielle Form ist die Nystagmographie
(ENG = Elektronystagmogramm). Nystagmen können horizontal (rechts
<--> links) oder vertikal auftreten. Zu Beginn einer Rotation
tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf
(perrotatorisch), bei Abbremsen zur Gegenseite (postrotatorisch)
Okulogramme (EOG = Elektrookulographie) sind Aufzeichnungen der
Augenbewegungen (Auge als elektrischer Dipol - vorne positiv, ~1 mV
korneo-retinales Potenzial, Ableitung von Schläfe und Nasenrücken).
Eine spezielle Form ist die Nystagmographie
(ENG = Elektronystagmogramm). Nystagmen können horizontal (rechts
<--> links) oder vertikal auftreten. Zu Beginn einer Rotation
tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf
(perrotatorisch), bei Abbremsen zur Gegenseite (postrotatorisch) Aufrichten des Kopfes um 60° bringt den lateralen Bogengang in
aufrechte Lage. Erwärmen oder Abkühlen seines lateralen Schenkels führt
dann zu Auf- oder Absteigen der Endolymphe, entsprechender Auslenkung
der Cupula und Auslösung des vestibulo-okulären Reflexes (”kalorischer Nystagmus“).
Die Sakkaden erfolgen auf die Seite der Erwärmung oder die Gegenseite
der Abkühlung. So kann eine getrennte Funktionsprüfung des linken und
rechten Vestibularorgans durchgeführt werden
Aufrichten des Kopfes um 60° bringt den lateralen Bogengang in
aufrechte Lage. Erwärmen oder Abkühlen seines lateralen Schenkels führt
dann zu Auf- oder Absteigen der Endolymphe, entsprechender Auslenkung
der Cupula und Auslösung des vestibulo-okulären Reflexes (”kalorischer Nystagmus“).
Die Sakkaden erfolgen auf die Seite der Erwärmung oder die Gegenseite
der Abkühlung. So kann eine getrennte Funktionsprüfung des linken und
rechten Vestibularorgans durchgeführt werden |
