

Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert


 Untersuchung der Verdauungsfunktionen
Untersuchung der Verdauungsfunktionen
 Angiografie: ανγειον = (Blut)Gefäß, γράφειν = schreiben, (auf)zeichnen
Angiografie: ανγειον = (Blut)Gefäß, γράφειν = schreiben, (auf)zeichnen| Funktionelle
Untersuchungen des gastrointestinalen Systems orientieren sich an
-- Druckwerten (Manometrie) -- Säurewert von Verdauungssekreten (pH-Metrie) -- Aufnahmefähigkeit der Darmschleimhaut (Resorptionstests) -- Leberfunktion (Plasmaproteine, Gerinnungsstatus, Eisenspiegel etc) -- Wasserstoff, Kohlendioxid u.a. in der Exspirationsluft (Atemgasanalysen) -- Exkretion (Stuhluntersuchung) Weiters kommen Organdarstellungen (CT, Sonografie), Angiografie (Gefäße, Gallengänge), endoskopische Untersuchungen, Punktionen (Leber) in Betracht. Eine Bestimmung von Enzymen hat die Aufschließung von Makromolekülen in der Nahrung im Blick; Antikörpermuster können auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungsgeschehen hinweisen. |

 Abbildung: Gastroskopie
Abbildung: Gastroskopie
 Bei der
körperlichen Untersuchung ist neben der Inspektion (Lagerung!),
Auskultation, Perkussion und Palpation eine Reihe apparativer
Diagnostiken möglich:
Bei der
körperlichen Untersuchung ist neben der Inspektion (Lagerung!),
Auskultation, Perkussion und Palpation eine Reihe apparativer
Diagnostiken möglich:  Radioskopische Verfahren
(Kontrastmitteluntersuchung, CT, Angiografie
Radioskopische Verfahren
(Kontrastmitteluntersuchung, CT, Angiografie  ) - z.B. Duodenum, Pankreas, Dünndarm, Dickdarm (Colonoskopie)
) - z.B. Duodenum, Pankreas, Dünndarm, Dickdarm (Colonoskopie) Gastroskopie
Gastroskopie
 (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie - mittels Gastroskop, einem speziellen
Endoskop
(Ösophago-Gastro-Duodenoskopie - mittels Gastroskop, einem speziellen
Endoskop  , mit dem u.a. auch die Entnahme von Gewebeproben möglich ist)
, mit dem u.a. auch die Entnahme von Gewebeproben möglich ist)  Sonographie
(Bildgebendes Ultraschall-Verfahren, 20 kHz bis 40 MHz; der Schall wird
von Grenzflächen reflektiert, an denen sich die akustische Impedanz
ändert)
Sonographie
(Bildgebendes Ultraschall-Verfahren, 20 kHz bis 40 MHz; der Schall wird
von Grenzflächen reflektiert, an denen sich die akustische Impedanz
ändert) Elektrische Ableitungen: Elektrogastrographie (EGG)
Elektrische Ableitungen: Elektrogastrographie (EGG) Nuklearmedizinische
Verfahren - Magenentleerung,
Divertikel, Blutungslokalisation - man bringt einen Tracer
(Radiopharmakon) in das entsprechende Körperkompartiment ein, die
Strahlung wird extrakorporal ermittelt
Nuklearmedizinische
Verfahren - Magenentleerung,
Divertikel, Blutungslokalisation - man bringt einen Tracer
(Radiopharmakon) in das entsprechende Körperkompartiment ein, die
Strahlung wird extrakorporal ermittelt Stuhluntersuchung - z.B. auf (okkultes) Blut, Giftstoffe, Erreger
Stuhluntersuchung - z.B. auf (okkultes) Blut, Giftstoffe, Erreger
 Abbildung: Rekto-analer inhibitorischer Reflex und Defäkation
Abbildung: Rekto-analer inhibitorischer Reflex und Defäkation
 Manometrie
Manometrie  (Ösophagus; Rectum -
(Ösophagus; Rectum -  Abbildung)
Abbildung) Langzeit-pH-Metrie
(Ösophagus, Magen)
Langzeit-pH-Metrie
(Ösophagus, Magen) Sekretionsanalyse (Magensaft)
Sekretionsanalyse (Magensaft) Resorptionstests
(Laktosetoleranztest; Schilling-Test
Resorptionstests
(Laktosetoleranztest; Schilling-Test  mit oraler Gabe von markiertem Vit. B12 (radioaktives 57Co), anschließend unmarkiertem Vitamin i.v. und Bestimmung der Ausscheidung im Urin)
mit oraler Gabe von markiertem Vit. B12 (radioaktives 57Co), anschließend unmarkiertem Vitamin i.v. und Bestimmung der Ausscheidung im Urin)  Atemtests (Wasserstoffausatmung: Laktosemaldigestion, Fruktosemalabsorption; CO2-Exhalation; Fragestellung Kohlenhydratabsorption bzw. bakterielle Überwucherung im Dünndarm)
Atemtests (Wasserstoffausatmung: Laktosemaldigestion, Fruktosemalabsorption; CO2-Exhalation; Fragestellung Kohlenhydratabsorption bzw. bakterielle Überwucherung im Dünndarm)
 s. dort
s. dort s. dort). Neben der körperlichen Untersuchung stehen mehrere
apparative Diagnosemethoden und Funktionstests zur Verfügung:
s. dort). Neben der körperlichen Untersuchung stehen mehrere
apparative Diagnosemethoden und Funktionstests zur Verfügung:  Enzyme (Testung auf Aufschließung einzelner Makromoleküle in der Nahrung)
Enzyme (Testung auf Aufschließung einzelner Makromoleküle in der Nahrung) Antikörper (Testung auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungen)
Antikörper (Testung auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungen) Gerinnungszeiten (Testung auf Resorption von Vitamin K)
Gerinnungszeiten (Testung auf Resorption von Vitamin K) Eisenspiegel (Testung auf Resorption von Eisen)
Eisenspiegel (Testung auf Resorption von Eisen)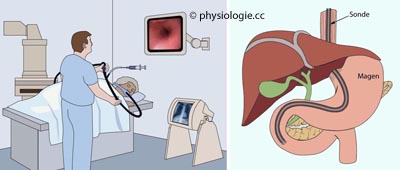
 Abbildung: Durchführung einer ERCP
Abbildung: Durchführung einer ERCP Plasmaproteine, je nach
Fragestellung (Testung auf Aminosäureresorption etc)
Plasmaproteine, je nach
Fragestellung (Testung auf Aminosäureresorption etc) Bildgebende Verfahren, Angiographie
Bildgebende Verfahren, Angiographie Laparoskopie
Laparoskopie  (Eingriff in die Bauchhöhle mittels optischen Instruments)
(Eingriff in die Bauchhöhle mittels optischen Instruments) Leberpunktion (Biopsie: diagnostische Gewebsentnahme)
Leberpunktion (Biopsie: diagnostische Gewebsentnahme) ERCP (endoskopische retrograde
Cholangiopankreatikographie,
ERCP (endoskopische retrograde
Cholangiopankreatikographie,  Abbildung)
Abbildung) PTC (perkutane transhepatische
Cholangiografphie)
PTC (perkutane transhepatische
Cholangiografphie) Szintigraphie
Szintigraphie 
