

Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Integration der Organsysteme




| Die
Haut ist Sinnesorgan (Mechano-, Thermo-, Nozizeption), immunologische Barriere, Vitaminproduzent (D-Hormon),
Wärmeaustauscher, Schweißproduzent und schützt
vor Strahlung und Austrocknung. Ihre Durchblutung kann so groß werden
wie das gesamte Ruhe-Herzminutenvolumen (vasodilatierende Wirkung von
Kininen); die Haut kann in ihren Venengeflechten beträchtliche Mengen Blut speichen. Interstitielle Flüssigkeit gelangt über kutane Lymphgefäße in den Kreislauf. Vor Strahlung schützt die Pigmentierung (Melanozyten bilden Eumelanin und transferieren es an Keratinozyten). Eine erwachsene Person kann bei Hitzeeinfluss bis zu 3 Liter Schweiß pro Stunde produzieren (pro Tag bis >10 Liter). Dabei verliert der Körper außer Wasser auch Natrium, Chlorid, Lactat (Schweiß-pH ~4,5) sowie geringe Mengen an Harnstoff, Aminosäuren, Laktoferrin, evt. Pharmaka (z.B. Kokain, Opiate), Magnesium. Schweiß ist hypoton, die osmotisch bedeutsamste Komponente ist Kochsalz. Afferente Nervenfasern bringen Information über Berührung, Vibration, Kälte und Wärme, sowie Schmerz an das Zentralnervensystem heran; autonom-efferente Nerven steuern Gefäße und Drüsen (Schweiß, Talg, Pheromone). Kutane Neurone vermitteln Axonreflexe und interagieren mit - teilweise trophischen - Faktoren wie CGRP, NPY, Substanz P, VIP, Neurokinin A und Somatostatin; diese wirken z.T. als trophische Signalsubstanzen. |
 Schweiß
Schweiß  Hautdurchblutung
Hautdurchblutung  Hautfarbe und Pigmentierung
Hautfarbe und Pigmentierung  immunologische Eigenschaften
immunologische Eigenschaften  Sinnesorgan Haut
Sinnesorgan Haut Melanin
Melanin
 Core messages
Core messages
 Abbildung: Aufbau der menschlichen Haut
Abbildung: Aufbau der menschlichen Haut
 Abbildung; überlappende Zellen und interzelluläre Lipide) verhindert die Haut unkontrollierten Wasserverlust über ihre Oberfläche von ~2m2. So diffundieren nur geringe Mengen von Wasser durch die Haut nach außen und werden an die Umgebung abgegeben (Teil der perspiratio insensibilis,
welche auch den Wasserverlust durch die Atmung umfasst und insgesamt
pro Stunde 20-50 ml beträgt; diese Verdampfung verursacht einen Teil
des evaporativen Wärmeverlusts des Körpers).
Abbildung; überlappende Zellen und interzelluläre Lipide) verhindert die Haut unkontrollierten Wasserverlust über ihre Oberfläche von ~2m2. So diffundieren nur geringe Mengen von Wasser durch die Haut nach außen und werden an die Umgebung abgegeben (Teil der perspiratio insensibilis,
welche auch den Wasserverlust durch die Atmung umfasst und insgesamt
pro Stunde 20-50 ml beträgt; diese Verdampfung verursacht einen Teil
des evaporativen Wärmeverlusts des Körpers).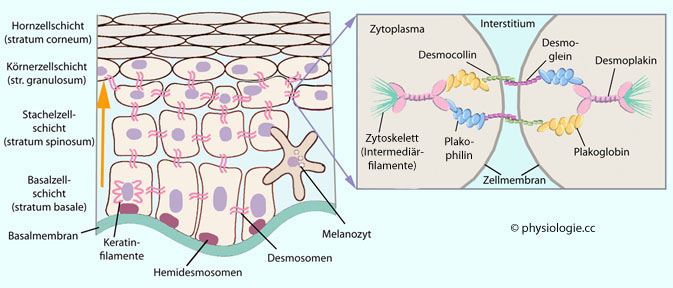

 Abbildung: Epidermis und Desmosom (schematisch)
Abbildung: Epidermis und Desmosom (schematisch)
 Größtes Sinnesorgan; die Haut nimmt Sinnesreize auf (Oberflächensensibilität, Temperatur-, Schmerzsinn - die Oberhaut ist durchschnittlich 2-3 mm dick und wiegt ~5 kg) und leitet diese Information weiter - die Haut enthält schätzungsweise ~80 km Nervenfasern
Größtes Sinnesorgan; die Haut nimmt Sinnesreize auf (Oberflächensensibilität, Temperatur-, Schmerzsinn - die Oberhaut ist durchschnittlich 2-3 mm dick und wiegt ~5 kg) und leitet diese Information weiter - die Haut enthält schätzungsweise ~80 km Nervenfasern Mechanischer / physikochemischer Schutz (vor
Eindringen von Fremdstoffen, Verlust von Körperflüssigkeit) - ohne
Epidermis würde der tägliche Flüssigkeitsverlust über Verdampfung etwa
20 Liter betragen. Die Abdichtung erfolgt über Desmosomen (an ihnen
verankern sich Keratinfäden - Tonofilamente, Intermediärfilamente - in der Zelle), Schlussleisten (tight
junctions) u.a.; in die extrazellulären Spalträume zwischen den
Epithelzellen sind Lipide zur Abdichtung eingelagert
Mechanischer / physikochemischer Schutz (vor
Eindringen von Fremdstoffen, Verlust von Körperflüssigkeit) - ohne
Epidermis würde der tägliche Flüssigkeitsverlust über Verdampfung etwa
20 Liter betragen. Die Abdichtung erfolgt über Desmosomen (an ihnen
verankern sich Keratinfäden - Tonofilamente, Intermediärfilamente - in der Zelle), Schlussleisten (tight
junctions) u.a.; in die extrazellulären Spalträume zwischen den
Epithelzellen sind Lipide zur Abdichtung eingelagert Anregung der Synthese proinflammatorischer Komponenten bei Verletzungen der Haut (
Anregung der Synthese proinflammatorischer Komponenten bei Verletzungen der Haut (  Abbildung)
Abbildung)
 Abbildung: Reaktionen eines Keratinozyten auf einen Verletzungsreiz
Abbildung: Reaktionen eines Keratinozyten auf einen Verletzungsreiz
 Aufenthaltsort von ~1012 Mikroorganismen (Hautflora), immunologischer Infektionsschutz, vor allem angeboren (residente - im Gegensatz zur transienten - Hautflora)
Aufenthaltsort von ~1012 Mikroorganismen (Hautflora), immunologischer Infektionsschutz, vor allem angeboren (residente - im Gegensatz zur transienten - Hautflora) Thermischer Ausgleich - Wasserverlust und Schweißsekretion (bis zu mehrere hundert Schweißdrüsen pro cm2 Haut, am dichtesten an den Fußsohlen), Wärmeaustausch.
Thermischer Ausgleich - Wasserverlust und Schweißsekretion (bis zu mehrere hundert Schweißdrüsen pro cm2 Haut, am dichtesten an den Fußsohlen), Wärmeaustausch. Der Mensch verfügt über ~5.106 Haare. Ein Haar kann ~3 kg Gewicht tragen. Haare wachsen pro Woche um ~2 mm; die musculi arrectores pilorum sind glatte Muskelzellen. Piloerektion
Der Mensch verfügt über ~5.106 Haare. Ein Haar kann ~3 kg Gewicht tragen. Haare wachsen pro Woche um ~2 mm; die musculi arrectores pilorum sind glatte Muskelzellen. Piloerektion  ("Gänsehaut") trägt beim Menschen - wegen der niedrigen Haardichte
(Fehlen eines thermisch wirksamen Fells) nur geringgradig zur
thermischen Isolierung bei (Kleidung ist wirksamer, s. dort).
("Gänsehaut") trägt beim Menschen - wegen der niedrigen Haardichte
(Fehlen eines thermisch wirksamen Fells) nur geringgradig zur
thermischen Isolierung bei (Kleidung ist wirksamer, s. dort). Wärmeisolierung - subkutanes Fett
wirkt als effektive thermische Isolierschichte (seine Wärmeleitung ist
nur halb so groß wie die von Muskelgewebe) und verringert den
Wärmeverlust des Organismus in kühler Umgebung (insbesondere in kaltem
Wasser, das Wärme viel rascher ableitet als Luft). Je mehr subkutanes
Fett vorhanden ist, desto besser ist die thermische Abdichtung.
Wärmeisolierung - subkutanes Fett
wirkt als effektive thermische Isolierschichte (seine Wärmeleitung ist
nur halb so groß wie die von Muskelgewebe) und verringert den
Wärmeverlust des Organismus in kühler Umgebung (insbesondere in kaltem
Wasser, das Wärme viel rascher ableitet als Luft). Je mehr subkutanes
Fett vorhanden ist, desto besser ist die thermische Abdichtung.  Schutz vor Strahlung -
Schutz vor Strahlung -  s. dort
s. dort 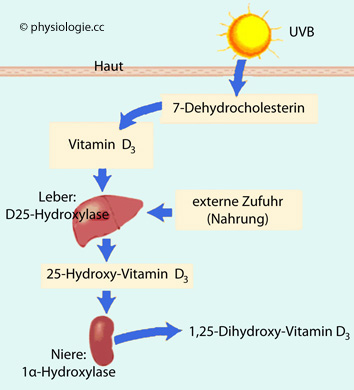
 Abbildung: Haut und Vitamin D-Synthese
Abbildung: Haut und Vitamin D-Synthese
 Vitamin D-Synthese in Keratinozyten
Vitamin D-Synthese in Keratinozyten  (7-Dehydrocholesterin → UV-B-Strahlung → 25-Hydroxycholecalciferol). Vitamin D3
entsteht in der Haut unter Einwirkung von UV-B-Licht (280-320 nm) aus
7-Dehydrocholesterin (
(7-Dehydrocholesterin → UV-B-Strahlung → 25-Hydroxycholecalciferol). Vitamin D3
entsteht in der Haut unter Einwirkung von UV-B-Licht (280-320 nm) aus
7-Dehydrocholesterin ( Abbildung). In einem weiteren Schritt konvertiert die Leber Vitamin D3
mittels Vitamin-D-25-Hydroxylase zu 25(OH)-Vitamin D3, die Niere
schließlich mittels 1α-Hydroxylase zur biologisch aktiven Form 1,25(OH)2-Vitamin D3 (Calcitriol). Dieser letzte Schritt steht unter mehrfacher hormoneller Kontrolle (Parathormon, Calcitonin).
Abbildung). In einem weiteren Schritt konvertiert die Leber Vitamin D3
mittels Vitamin-D-25-Hydroxylase zu 25(OH)-Vitamin D3, die Niere
schließlich mittels 1α-Hydroxylase zur biologisch aktiven Form 1,25(OH)2-Vitamin D3 (Calcitriol). Dieser letzte Schritt steht unter mehrfacher hormoneller Kontrolle (Parathormon, Calcitonin). Schutz vor Austrocknung sowie immunologischer Schutz durch die Aktivität von Schweiß- (sweat glands) und Talgdrüsen (sebaceous glands), die sich vor allem in der Achselhöhle und der Perianalregion finden.
Schutz vor Austrocknung sowie immunologischer Schutz durch die Aktivität von Schweiß- (sweat glands) und Talgdrüsen (sebaceous glands), die sich vor allem in der Achselhöhle und der Perianalregion finden.  Abbildung):
Abbildung):  Ekkrine
Ekkrine  Drüsen produzieren Schweiß für die Thermoregulation (größte Drüsendichte im Bereich der Handflächen und Fußsohlen - über Schweiß
Drüsen produzieren Schweiß für die Thermoregulation (größte Drüsendichte im Bereich der Handflächen und Fußsohlen - über Schweiß  s. unten).
s. unten). Apokrine
Apokrine  Duftdrüsen
sind ähnlich strukturiert wie ekkrine, münden aber in Haartrichter
(Achselhöhle, Genitalregion). Ihr Sekret enthält Proteine, Lipide und
Steroide. Ihre Funktion wird durch Katecholamine angeregt, d.h. in
Situationen von Stress, Angst, sexueller Erregung.
Duftdrüsen
sind ähnlich strukturiert wie ekkrine, münden aber in Haartrichter
(Achselhöhle, Genitalregion). Ihr Sekret enthält Proteine, Lipide und
Steroide. Ihre Funktion wird durch Katecholamine angeregt, d.h. in
Situationen von Stress, Angst, sexueller Erregung. 
 Abbildung: Drüsen in der Haut
Abbildung: Drüsen in der Haut
 Perspiratio insensibilis,
die ohne Aktivierung der Schweißdrüsen über Haut
und Atmung abgegebene Flüssigkeitsmenge - etwa 10 ml/kg Körpergewicht / 24 Stunden
(0,3 - 1,0 l/d), bei einer erwachsenen Person kann von einem auf diesem
Weg erfolgenden (unvermeidlichen) täglichen Flüssigkeitsverlust von gut
einem halben Liter ausgegangen werden
Perspiratio insensibilis,
die ohne Aktivierung der Schweißdrüsen über Haut
und Atmung abgegebene Flüssigkeitsmenge - etwa 10 ml/kg Körpergewicht / 24 Stunden
(0,3 - 1,0 l/d), bei einer erwachsenen Person kann von einem auf diesem
Weg erfolgenden (unvermeidlichen) täglichen Flüssigkeitsverlust von gut
einem halben Liter ausgegangen werden Perspiratio sensibilis, die durch Aktivierung der Schweißproduktion abgegebene Flüssigkeitsmenge - kann von Null bis zu mehreren Litern pro Tag betragen
Perspiratio sensibilis, die durch Aktivierung der Schweißproduktion abgegebene Flüssigkeitsmenge - kann von Null bis zu mehreren Litern pro Tag betragen Repräsentation nach außen bzw. Kommunikation (Hautbeschaffenheit, Farbe, Durchblutung - Erröten! -, Pheromone
Repräsentation nach außen bzw. Kommunikation (Hautbeschaffenheit, Farbe, Durchblutung - Erröten! -, Pheromone  ).
Schweiß (aus apokrinen Drüsen,
).
Schweiß (aus apokrinen Drüsen,  Abbildung) enthält Duftstoffe, die Information über
den emotionalen Zustand des "Senders" beinhalten (z.B. "Angstschweiß":
Dieser enthält Stoffe, die über den Geruchssinn unbewusst die
Gehirnaktivität beeinflussen).
Abbildung) enthält Duftstoffe, die Information über
den emotionalen Zustand des "Senders" beinhalten (z.B. "Angstschweiß":
Dieser enthält Stoffe, die über den Geruchssinn unbewusst die
Gehirnaktivität beeinflussen).
 Resorption: Über die Haut können fettlösliche Wirkstoffe (transdermale therapeutische Systeme), aber auch Gifte (z.B. Phenole) aufgenommen werden.
Höhermolekulare bzw. hydrophile Stoffe (z.B. Desinfektionsmittel)
werden hingegen von der Haut kaum aufgenommen. Das stratum corneum
stellt die Hauptbarriere dar (Wassergehalt <10%, zum Vergleich: ~70%
im Korium).
Resorption: Über die Haut können fettlösliche Wirkstoffe (transdermale therapeutische Systeme), aber auch Gifte (z.B. Phenole) aufgenommen werden.
Höhermolekulare bzw. hydrophile Stoffe (z.B. Desinfektionsmittel)
werden hingegen von der Haut kaum aufgenommen. Das stratum corneum
stellt die Hauptbarriere dar (Wassergehalt <10%, zum Vergleich: ~70%
im Korium). idg. sueid- schwitzen
idg. sueid- schwitzen Zusammensetzung / Komponenten
Zusammensetzung / Komponenten
 Abbildung: Schweißproduktion
Abbildung: Schweißproduktion
 Apikale / basolaterale Membran s. dort
Apikale / basolaterale Membran s. dort Verdampfungswärme: Da der Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf pro Liter 2,4 MJ (~570 Cal) Energie erfordert, kommt es durch das Verdunsten von Schweiß an der Körperoberfläche zu effizienter Abkühlung auch dann, wenn die Lufttemperatur über
der Hauttemperatur liegt. (Vorausgesetzt, die Luft ist nicht
wasserdampfgesättigt, was z.B. in den Tropen der Fall sein kann - dann
funktioniert die Hitzeabfuhr über Evaporation nicht mehr,
Kreislauf und Wärmeregulation sind extrem belastet.)
Verdampfungswärme: Da der Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf pro Liter 2,4 MJ (~570 Cal) Energie erfordert, kommt es durch das Verdunsten von Schweiß an der Körperoberfläche zu effizienter Abkühlung auch dann, wenn die Lufttemperatur über
der Hauttemperatur liegt. (Vorausgesetzt, die Luft ist nicht
wasserdampfgesättigt, was z.B. in den Tropen der Fall sein kann - dann
funktioniert die Hitzeabfuhr über Evaporation nicht mehr,
Kreislauf und Wärmeregulation sind extrem belastet.) s. dort). Die
Schweißdrüsen werden durch sympathische Fasern über muskarinische Rezeptoren cholinerg (!) angeregt (nicht noradrenerg wie sonst bei sympathisch-postganglionären Fasern).
s. dort). Die
Schweißdrüsen werden durch sympathische Fasern über muskarinische Rezeptoren cholinerg (!) angeregt (nicht noradrenerg wie sonst bei sympathisch-postganglionären Fasern).| Acetylcholin regt die Schweißsekretion über muskarinerge Rezeptoren an |
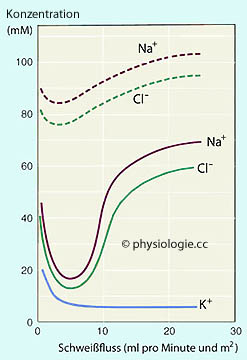
 Abbildung: Zusammensetzung des Schweißes als Funktion der Sekretionsrate
Abbildung: Zusammensetzung des Schweißes als Funktion der Sekretionsrate
 Abbildung).
Abbildung).  Abbildung).
Abbildung).  s. dort):
s. dort):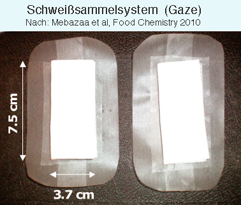
| Elektrolyte im Schweiß |
|||
| Na+ | ~1,2 g/l (~50 mM) (Serum 142 mM) |
Ca++ |
~15 mg/l (~0,4 mM) (Serum 2,5 mM) |
| K+ | ~0,1 g/l (~5 mM) (Serum 4 mM) |
Mg++ | ~1,3 mg/l (~0,05 mM) (Serum 0,9 mM) |
| Spurenelemente im Schweiß |
|||
| Fe++ |
~1 mg/l (Serum 0,7-1,8 mg/l) |
Cu++ | ~0,5 mg/l (Serum 0,75-1,3 mg/l) |
| Zn++ | ~0,4 mg/l (Serum 0,6-1,4 mg/l) |
Cr+++ | ~0,1 mg/l (Serum 0,02-0,05 mg/l) |
 vgl. dort)
und können große Mengen Blut aufnehmen; das geschieht bei erhöhter
Hautperfusion (ist also weitgehend über die arterielle Durchblutung gesteuert), die bei intensivem Hitzeeinfluss bis zu etwa 5 l/min betragen kann (das Ruhe-Herzzeitvolumen wird dadurch verdoppelt).
vgl. dort)
und können große Mengen Blut aufnehmen; das geschieht bei erhöhter
Hautperfusion (ist also weitgehend über die arterielle Durchblutung gesteuert), die bei intensivem Hitzeeinfluss bis zu etwa 5 l/min betragen kann (das Ruhe-Herzzeitvolumen wird dadurch verdoppelt). 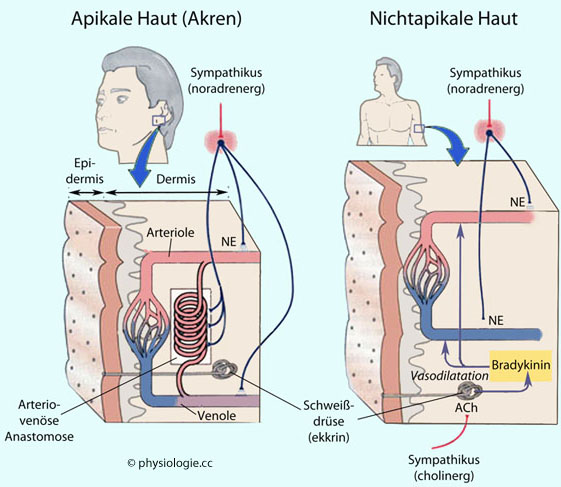
 Abbildung: Strukturierung der Durchblutung von Akren (apical skin) und "normaler" Haut
Abbildung: Strukturierung der Durchblutung von Akren (apical skin) und "normaler" Haut (Finger- und Zehenspitzen, Handflächen, Fußsohlen, Lippen, Nase,
Ohrläppchen) finden sich arteriovenöse Anastomosen (im Nagelbett ca.
500 / cm2). Diese haben einen niedrigen Ruhetonus und
werden fast ausschließlich noradrenerg (vasokonstriktorisch) vom
hypothalamischen Wärmezentrum gesteuert. Sie reagieren auch auf die lokale Temperatur - dilatieren bei Wärme, kontrahieren bei Kälte.
(Finger- und Zehenspitzen, Handflächen, Fußsohlen, Lippen, Nase,
Ohrläppchen) finden sich arteriovenöse Anastomosen (im Nagelbett ca.
500 / cm2). Diese haben einen niedrigen Ruhetonus und
werden fast ausschließlich noradrenerg (vasokonstriktorisch) vom
hypothalamischen Wärmezentrum gesteuert. Sie reagieren auch auf die lokale Temperatur - dilatieren bei Wärme, kontrahieren bei Kälte.
 Abbildung) und eine wichtige Rolle für die
Thermoregulation spielen:
Abbildung) und eine wichtige Rolle für die
Thermoregulation spielen: Steigt die Kerntemperatur, dann sinkt der sympathische Antrieb, die Anastomosen in den Akren öffnen sich, die angeschlossenen Venenplexus werden gefüllt - und das erleichtert die Wärmeabgabe an die Umgebung.
Steigt die Kerntemperatur, dann sinkt der sympathische Antrieb, die Anastomosen in den Akren öffnen sich, die angeschlossenen Venenplexus werden gefüllt - und das erleichtert die Wärmeabgabe an die Umgebung.| Bei Kälteeinfluss kontrahiert Noradrenalin kutane Arteriolen |
 Abbildung) erhöht die Durchblutung der Akren um das ~4-fache. Im Ruhezustand besteht also in den Akren ein erheblicher Sympathikustonus.
Abbildung) erhöht die Durchblutung der Akren um das ~4-fache. Im Ruhezustand besteht also in den Akren ein erheblicher Sympathikustonus.
 Abbildung: Wirkung sympathischer Blockade auf die Durchblutung der Hand
Abbildung: Wirkung sympathischer Blockade auf die Durchblutung der Hand
 Die kutane Perfusion ist extrem variabel. Unter Ruhebedingungen und
Indifferenztemperatur beträgt die Durchblutung der Haut einer
erwachsenen Person ~6% des Herzminutenvolumens (ca. 1/3 l/min). Die spezifische Durchblutung beträgt dann 10-20 ml/min/100g. Die minimale Durchblutung (z.B. bei intensivem Kälteeinfluss) beträgt lediglich 1 ml/min/100g, maximale Durchblutung hingegen (Hitzeeinfluss) 150-200 ml/min/100g.
Die kutane Perfusion ist extrem variabel. Unter Ruhebedingungen und
Indifferenztemperatur beträgt die Durchblutung der Haut einer
erwachsenen Person ~6% des Herzminutenvolumens (ca. 1/3 l/min). Die spezifische Durchblutung beträgt dann 10-20 ml/min/100g. Die minimale Durchblutung (z.B. bei intensivem Kälteeinfluss) beträgt lediglich 1 ml/min/100g, maximale Durchblutung hingegen (Hitzeeinfluss) 150-200 ml/min/100g. Hoher
Sympathikustonus oder extreme Kälte kann die Hautdurchblutung bis auf ein Zwanzigstel
reduzieren (auf ~20 ml/min). Die Vasokonstriktion wird über α2-Rezeptoren vermittelt
Hoher
Sympathikustonus oder extreme Kälte kann die Hautdurchblutung bis auf ein Zwanzigstel
reduzieren (auf ~20 ml/min). Die Vasokonstriktion wird über α2-Rezeptoren vermittelt  Umgekehrt vervielfacht sich die
kutane Perfusion unter der Wirkung von Hitze (z.B. Saunabesuch) und
kann Werte von mehreren l/min erreichen. Die Wirkung erfolgt über erhöhte eNOS-Aktivität, teils auch über Substanz P und CGRP.
Umgekehrt vervielfacht sich die
kutane Perfusion unter der Wirkung von Hitze (z.B. Saunabesuch) und
kann Werte von mehreren l/min erreichen. Die Wirkung erfolgt über erhöhte eNOS-Aktivität, teils auch über Substanz P und CGRP. 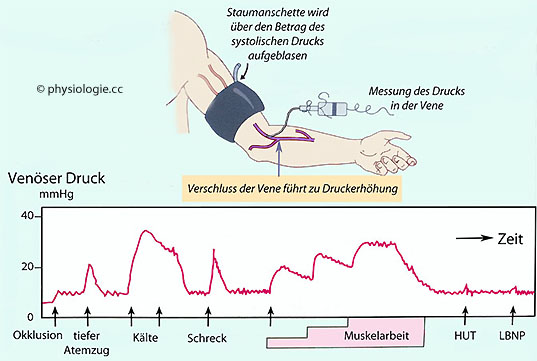
 Abbildung: Sympathikuswirkung auf Hautvenen
Abbildung: Sympathikuswirkung auf Hautvenen
 Abbildung).
Abbildung). Als Melanin
Als Melanin  bezeichnet man eine Gruppe von oligo- bis polymer angeordneten Biomolekülen, die von Melanozyten gebildet werden (Melanogegese)
und Haut, Schleimhäute, Gehirnhäute, Sinnesorgane (Iris) u.a.
pigmentieren.
bezeichnet man eine Gruppe von oligo- bis polymer angeordneten Biomolekülen, die von Melanozyten gebildet werden (Melanogegese)
und Haut, Schleimhäute, Gehirnhäute, Sinnesorgane (Iris) u.a.
pigmentieren. 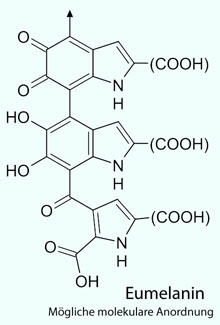
 Abbildung: Strukturvariante von Eumelanin
Abbildung: Strukturvariante von Eumelanin
 Abbildung), gefolgt von Phäo-,
Neuro- und anderen Melaninen. Chemischer Ausgangspunkt ist die
Oxidation der Aminosäure Tyrosin. Die Pigmentierung der Haut verleiht
Schutz vor Strahlung (UV), darüber hinaus gehende biologische
Bedeutungen diverser Pigmentierungen sind nur zum Teil bekannt.
Abbildung), gefolgt von Phäo-,
Neuro- und anderen Melaninen. Chemischer Ausgangspunkt ist die
Oxidation der Aminosäure Tyrosin. Die Pigmentierung der Haut verleiht
Schutz vor Strahlung (UV), darüber hinaus gehende biologische
Bedeutungen diverser Pigmentierungen sind nur zum Teil bekannt. 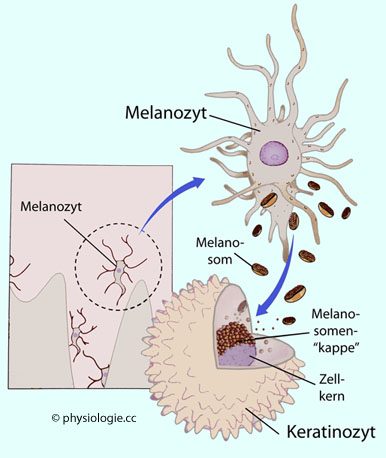
 Abbildung: Melaninproduktion
Abbildung: Melaninproduktion
 Abbildung) aus Prämelanosomen.
Abbildung) aus Prämelanosomen.  (das weniger UV-Schutz verleiht) als dunkle Hauttypen, die mehr Eumelanin bilden und bei denen die Melaninbildung früher beginnt als bei Hellhäutigen. Das dunkelbraun bis schwarz gefärbte Eumelanin bietet einen intensiveren UV-Schutz.
(das weniger UV-Schutz verleiht) als dunkle Hauttypen, die mehr Eumelanin bilden und bei denen die Melaninbildung früher beginnt als bei Hellhäutigen. Das dunkelbraun bis schwarz gefärbte Eumelanin bietet einen intensiveren UV-Schutz.
 UV-A
(langwellig: Untergrenze 315-320 nm, Obergrenze 380-400 nm) bewirkt
Konformationsänderung des Melanins und
damit direkte Pigmentierung. Belichtung mit UV-A führt zu
geringgradiger Hautrötung (Erythem), die nur kurz andauert und keinen
wesentlichen Lichtschutz verleiht. Zu den schädigenden Effekten von UV-A gehören Sauerstoffradikalbildung, Kollagenalterung und
Melanomrisiko
UV-A
(langwellig: Untergrenze 315-320 nm, Obergrenze 380-400 nm) bewirkt
Konformationsänderung des Melanins und
damit direkte Pigmentierung. Belichtung mit UV-A führt zu
geringgradiger Hautrötung (Erythem), die nur kurz andauert und keinen
wesentlichen Lichtschutz verleiht. Zu den schädigenden Effekten von UV-A gehören Sauerstoffradikalbildung, Kollagenalterung und
Melanomrisiko UV-B
(kurzwellig: Untergrenze 280-290 nm, Obergrenze 315-320 nm) ist für die Bildung des Vitamin-D-Hormons in der Haut erforderlich. Es ist stärker erythembildend (Sonnenbrand) und bewirkt verzögerte Pigmentierung (~3
Tage), die länger anhält und schützt. UV-B-Bestrahlung kann starke kanzerogene Effekte haben
(Basalzell-, Plattenepithelkarzinom)
UV-B
(kurzwellig: Untergrenze 280-290 nm, Obergrenze 315-320 nm) ist für die Bildung des Vitamin-D-Hormons in der Haut erforderlich. Es ist stärker erythembildend (Sonnenbrand) und bewirkt verzögerte Pigmentierung (~3
Tage), die länger anhält und schützt. UV-B-Bestrahlung kann starke kanzerogene Effekte haben
(Basalzell-, Plattenepithelkarzinom) UV-C (sehr
kurzwellig: bis 290 nm) wird im Gewebe stark gestreut und dringt daher
nicht tief in die Haut ein. Die Erdatmosphäre absorbiert den Großteil des UV-C aus dem
Sonnenlicht
UV-C (sehr
kurzwellig: bis 290 nm) wird im Gewebe stark gestreut und dringt daher
nicht tief in die Haut ein. Die Erdatmosphäre absorbiert den Großteil des UV-C aus dem
Sonnenlicht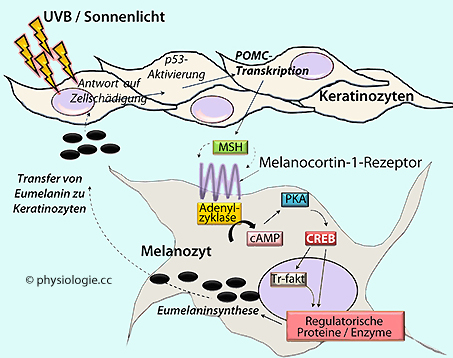
 Abbildung: Mechanismus der Hautbräunung
Abbildung: Mechanismus der Hautbräunung
 Abbildung).
Abbildung).  Das dunkelbraune Eumelanin (es gibt schwarzes und braunes Eumelanin) wird aus Tyrosin und Levodopa gebildet und überwiegt bei dunklen Haar- und Hauttypen
Das dunkelbraune Eumelanin (es gibt schwarzes und braunes Eumelanin) wird aus Tyrosin und Levodopa gebildet und überwiegt bei dunklen Haar- und Hauttypen
 das gelblich-rötliche, schwefelhaltige Phäomelanin dominiert bei helleren Hauttypen
das gelblich-rötliche, schwefelhaltige Phäomelanin dominiert bei helleren Hauttypen Neuromelanin findet sich im Gehirn, insbesondere in katecholaminergen Zellen der substantia nigra (pars compacta) sowie im locus coeruleus.
Neuromelanin findet sich im Gehirn, insbesondere in katecholaminergen Zellen der substantia nigra (pars compacta) sowie im locus coeruleus.
 s. auch dort).
s. auch dort). Gut durchblutete Haut erscheint
stärker koloriert (Erröten) als schlecht durchblutete (Erblassen) - damit ist die Haut auch ein Instrument der Mitteilung emotionaler Prozesse (Wut, Angst, Schock)
Gut durchblutete Haut erscheint
stärker koloriert (Erröten) als schlecht durchblutete (Erblassen) - damit ist die Haut auch ein Instrument der Mitteilung emotionaler Prozesse (Wut, Angst, Schock) An
dünnen Hautpartien (insbesondere den Lippen) lässt sich die
Sauerstoffsättigung des Blutes erkennen: Ist diese geringer als ~70%
(arterielles Blut ist normalerweise zu >95% sauerstoffgesättigt),
erscheinen die Lippen blau (Zyanose).
Grund kann eine kältebedingte Unterdurchblutung (mit starker
Sauerstoffausnützung), mangelnde Arterialisierung des Blutes in der
Lunge, oder ausgedehnte arterio-venöse shunts (Herzfehler) sein.
An
dünnen Hautpartien (insbesondere den Lippen) lässt sich die
Sauerstoffsättigung des Blutes erkennen: Ist diese geringer als ~70%
(arterielles Blut ist normalerweise zu >95% sauerstoffgesättigt),
erscheinen die Lippen blau (Zyanose).
Grund kann eine kältebedingte Unterdurchblutung (mit starker
Sauerstoffausnützung), mangelnde Arterialisierung des Blutes in der
Lunge, oder ausgedehnte arterio-venöse shunts (Herzfehler) sein.  Abbildung):
Abbildung):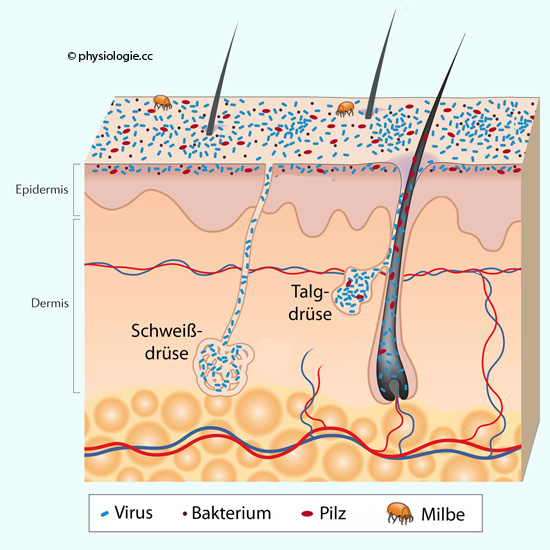
 Abbildung: Mikroorganismen in der Haut
Abbildung: Mikroorganismen in der Haut
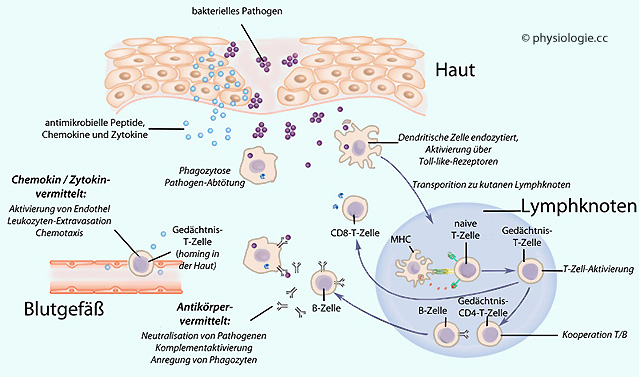
 Abbildung: Interaktion zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem in der Haut
Abbildung: Interaktion zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem in der Haut
 Der niedrige pH-Wert der Haut (um 5,5 - “Säuremantel”) hemmt das Wachstum
einiger Pathogene (antimikrobielle Wirkung von Fettsäuren), dasjenige physiologischer Hautbewohner
(Normalflora) hingegen nicht. Oftmaliges Waschen mit Seife hat nur flüchtige Effekte, die Verschiebung des pH auf der Hautoberfläche bildet sich nach wenigen Stunden wieder zurück.
Der niedrige pH-Wert der Haut (um 5,5 - “Säuremantel”) hemmt das Wachstum
einiger Pathogene (antimikrobielle Wirkung von Fettsäuren), dasjenige physiologischer Hautbewohner
(Normalflora) hingegen nicht. Oftmaliges Waschen mit Seife hat nur flüchtige Effekte, die Verschiebung des pH auf der Hautoberfläche bildet sich nach wenigen Stunden wieder zurück. Von Keratinozyten und Drüsen produzierte Peptide (AMPs: antimicrobial peptides), u.a. Lysozyme
(die auch in
Tränenflüssigkeit, Nasensekret und Speichel vorkommen), Beta-Defensin,
S100 (ein niedrigmolekulares Enzym, das von zahlreichen Zellen - auch
Keratinozyten - produziert wird), Granine (saure Proteine, z.B. das
gegen Bakterien, Hefen und Pilze wirksame Catestatin), Cathelicidine.
Schweißdrüsen (ekkrin) sezernieren auch ein 110-AS-Protein (Dermcidin), aus dem auf der
Haut bakterizide ("natürliches Breitbandantibiotikum") und antifungale
Peptide abgespaltet werden (wie der proteolysis-inducing factor PIF), die bei niedrigem pH-Wert
("Säureschutzmantel" der Haut) stabil sind und einen Teil der angeborenen Immunabwehr darstellen.
Von Keratinozyten und Drüsen produzierte Peptide (AMPs: antimicrobial peptides), u.a. Lysozyme
(die auch in
Tränenflüssigkeit, Nasensekret und Speichel vorkommen), Beta-Defensin,
S100 (ein niedrigmolekulares Enzym, das von zahlreichen Zellen - auch
Keratinozyten - produziert wird), Granine (saure Proteine, z.B. das
gegen Bakterien, Hefen und Pilze wirksame Catestatin), Cathelicidine.
Schweißdrüsen (ekkrin) sezernieren auch ein 110-AS-Protein (Dermcidin), aus dem auf der
Haut bakterizide ("natürliches Breitbandantibiotikum") und antifungale
Peptide abgespaltet werden (wie der proteolysis-inducing factor PIF), die bei niedrigem pH-Wert
("Säureschutzmantel" der Haut) stabil sind und einen Teil der angeborenen Immunabwehr darstellen. Lipide in Zellen und Sekreten.
Lipide in Zellen und Sekreten.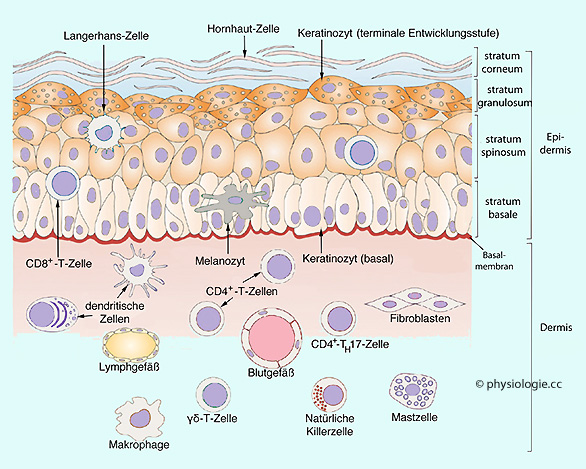
 Abbildung: Immunsystem der Haut
Abbildung: Immunsystem der Haut
 - im Gewebe der Haut sitzende Makrophagen -
werden nach Antigenkontakt /
Phagozytose von Fremdkörpern aktiviert und differenzieren aus. Sie
bilden dabei Lektinrezeptoren, wandern in die Lymphknoten und
präsentieren Lymphozyten (über deren Rezeptoren) die Antigen-Abbauprodukte vermittels MHC.
- im Gewebe der Haut sitzende Makrophagen -
werden nach Antigenkontakt /
Phagozytose von Fremdkörpern aktiviert und differenzieren aus. Sie
bilden dabei Lektinrezeptoren, wandern in die Lymphknoten und
präsentieren Lymphozyten (über deren Rezeptoren) die Antigen-Abbauprodukte vermittels MHC.
 Abbildung: Dendritische Zellen werden durch Antigenkontakt mobilisiert
Abbildung: Dendritische Zellen werden durch Antigenkontakt mobilisiert
 Bei chirurgischen Eingriffen, Einführen
von Gefäßkathetern usw. muss der Übertritt von Mikroben in die Operationswunde
möglichst verhindert werden. Mikroorganismen sind von der Haut nicht restlos entfernbar, auch
wenn ihre Zahl durch intensives Reinigen (Seife, Bürste etc.) für mehrere
Stunden merklich reduziert ist (daher die Verwendung steriler
Handschuhe und die Abdeckung eines Operationsfeldes zusätzlich zur Desinfektion).
Bei chirurgischen Eingriffen, Einführen
von Gefäßkathetern usw. muss der Übertritt von Mikroben in die Operationswunde
möglichst verhindert werden. Mikroorganismen sind von der Haut nicht restlos entfernbar, auch
wenn ihre Zahl durch intensives Reinigen (Seife, Bürste etc.) für mehrere
Stunden merklich reduziert ist (daher die Verwendung steriler
Handschuhe und die Abdeckung eines Operationsfeldes zusätzlich zur Desinfektion).  Pro Tag werden etwa 10 Gramm Hornschuppen
abgestreift
Pro Tag werden etwa 10 Gramm Hornschuppen
abgestreift täglich verliert eine erwachsene Person ~100 Haare
täglich verliert eine erwachsene Person ~100 Haare  Haarwachstum ~2 mm pro Woche
Haarwachstum ~2 mm pro Woche
 Abbildung: Struktur und Funktion der kutanen Mechanosensibilität
Abbildung: Struktur und Funktion der kutanen Mechanosensibilität
 aktiv, sondern wirken auch als trophische Faktoren.
aktiv, sondern wirken auch als trophische Faktoren. Zahlreiche Studien haben
den gesundheitsfördernden Effekt intensiv variierender Umweltfaktoren
nachgewiesen. So werden Hautgefäße durch starken Temperaturwechsel
(z.B. kalte Dusche nach Aufguss: bis ~100°C) zu effizienterer
Regulation veranlasst und sind in der Lage, intensiver auf thermische
Stressoren zu reagieren. Bei Hypertonikern zeigt sich ein
blutdrucksenkender, bei Hypotonikern hingegen ein blutdrucksteigernder
Effekt regelmäßigen Saunabesuchs. Das "Abhärtungs"-Konzept besagt, dass Regulationsvorgänge (wie Gefäßreaktionen) durch intensive Reizmuster herausgefordert werden und die physiologische Bandbreite (Anpassungsfähigkeit) zunimmt.
Zahlreiche Studien haben
den gesundheitsfördernden Effekt intensiv variierender Umweltfaktoren
nachgewiesen. So werden Hautgefäße durch starken Temperaturwechsel
(z.B. kalte Dusche nach Aufguss: bis ~100°C) zu effizienterer
Regulation veranlasst und sind in der Lage, intensiver auf thermische
Stressoren zu reagieren. Bei Hypertonikern zeigt sich ein
blutdrucksenkender, bei Hypotonikern hingegen ein blutdrucksteigernder
Effekt regelmäßigen Saunabesuchs. Das "Abhärtungs"-Konzept besagt, dass Regulationsvorgänge (wie Gefäßreaktionen) durch intensive Reizmuster herausgefordert werden und die physiologische Bandbreite (Anpassungsfähigkeit) zunimmt.
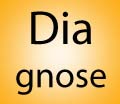 Mukoviszidose-Diagnostik: Bei Verdacht auf zystische Fibrose (Mukoviszidose) kann ein Schweißtest zur Bestimmung der Natrium- und Chloridwerte vorgenommen werden.
Mukoviszidose-Diagnostik: Bei Verdacht auf zystische Fibrose (Mukoviszidose) kann ein Schweißtest zur Bestimmung der Natrium- und Chloridwerte vorgenommen werden.  Zur Anregung der Schweißdrüsen verwendet man Pilokarpin, das muskarinisch wirkt (es regt auch den Speichelfluss an und senkt den Augeninnendruck).
Zur Anregung der Schweißdrüsen verwendet man Pilokarpin, das muskarinisch wirkt (es regt auch den Speichelfluss an und senkt den Augeninnendruck).  Die Haut ist das größte Sinnesorgan den Menschen (>10 kg, ~2 m2): Mechano-, Thermo-, Nozizeption Die Haut ist das größte Sinnesorgan den Menschen (>10 kg, ~2 m2): Mechano-, Thermo-, Nozizeption Sie schützt physikalisch (mechanisch, thermisch, Strahlung), chemisch
(Pufferwirkung), immunologisch (die Hautflora enthält ~1012 Mikroorganismen)
Sie schützt physikalisch (mechanisch, thermisch, Strahlung), chemisch
(Pufferwirkung), immunologisch (die Hautflora enthält ~1012 Mikroorganismen) Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt (UV-B: 280-320
nm; 7-Dehydrocholesterin → 25-Hydroxycholecalciferol)
Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt (UV-B: 280-320
nm; 7-Dehydrocholesterin → 25-Hydroxycholecalciferol) Sie schützt vor Flüssigkeitsverlust (das stratum corneum enthält
weniger als 10% Wasser), aber auch vor Austrocknung. 0,3-1,0 Liter
Flüssigkeit verliert die Haut pro Tag "passiv" (perspiratio
insensibilis), Schweißsekretion (aus ekkrinen Drüsen) unterstützt die
Thermoregulation (perspiratio sensibilis). Die Verdampfung von 1 Liter
Schweiß verbraucht 2,4 MJ Energie
Sie schützt vor Flüssigkeitsverlust (das stratum corneum enthält
weniger als 10% Wasser), aber auch vor Austrocknung. 0,3-1,0 Liter
Flüssigkeit verliert die Haut pro Tag "passiv" (perspiratio
insensibilis), Schweißsekretion (aus ekkrinen Drüsen) unterstützt die
Thermoregulation (perspiratio sensibilis). Die Verdampfung von 1 Liter
Schweiß verbraucht 2,4 MJ Energie Ekkrine Schweißdrüsen sezernieren in ihren Azini ein proteinfreies
Filtrat des Blutplasmas, die Ausführungsgänge resorbieren daraus
Kochsalz zurück, der Schweiß wird hypoton - die Osmolalität ist
abhängig von der Schweißproduktion
Ekkrine Schweißdrüsen sezernieren in ihren Azini ein proteinfreies
Filtrat des Blutplasmas, die Ausführungsgänge resorbieren daraus
Kochsalz zurück, der Schweiß wird hypoton - die Osmolalität ist
abhängig von der Schweißproduktion Die Durchblutung der Haut kann zwischen <0,1 und etwa 5 l/min
betragen - abhängig von den Erfordernissen der Thermoregulation. Die
Akren werden anders gesteuert (AV-Anastomosen, rein
noradrenerg-vasokonstriktorische Versorgung) als nichtapikale Haut
(auch Vasodilation möglich)
Die Durchblutung der Haut kann zwischen <0,1 und etwa 5 l/min
betragen - abhängig von den Erfordernissen der Thermoregulation. Die
Akren werden anders gesteuert (AV-Anastomosen, rein
noradrenerg-vasokonstriktorische Versorgung) als nichtapikale Haut
(auch Vasodilation möglich) Die Farbe der Haut hängt von Durchblutung (rötlich: gut
durchblutet, blass: schlecht durchblutet, bläulich: reduzierte
Sauerstoffsättigung) und Pigmentierung ab. UV-B regt in Keratinozyten
die Bildung von MSH an, dieses bewirkt in Melanozyten die Synthese von
Melanin, das von den Keratinozyten aufgenommen wird. Helle Haut enthält
Phäomelanin, dunkle Eumelanin
Die Farbe der Haut hängt von Durchblutung (rötlich: gut
durchblutet, blass: schlecht durchblutet, bläulich: reduzierte
Sauerstoffsättigung) und Pigmentierung ab. UV-B regt in Keratinozyten
die Bildung von MSH an, dieses bewirkt in Melanozyten die Synthese von
Melanin, das von den Keratinozyten aufgenommen wird. Helle Haut enthält
Phäomelanin, dunkle Eumelanin Keratinozyten bilden auch Zytokine und Chemokine, und kommunizieren so
mit Immunzellen. Schützend wirken der niedrige pH-Wert von 5-6, Lysozym
und andere Faktoren, sowie die obligate Keimbesiedelung. Mikrobielle
Merkmale (MAMPs: microbe-associated molecular patterns) werden mittels
Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors)
erkannt. Dendritische Zellen nehmen Fremdeiweiß auf und präsentieren es
in Lymphknoten vermittels MHC - und über deren Rezeptoren - an
Lymphozyten
Keratinozyten bilden auch Zytokine und Chemokine, und kommunizieren so
mit Immunzellen. Schützend wirken der niedrige pH-Wert von 5-6, Lysozym
und andere Faktoren, sowie die obligate Keimbesiedelung. Mikrobielle
Merkmale (MAMPs: microbe-associated molecular patterns) werden mittels
Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors)
erkannt. Dendritische Zellen nehmen Fremdeiweiß auf und präsentieren es
in Lymphknoten vermittels MHC - und über deren Rezeptoren - an
Lymphozyten |
